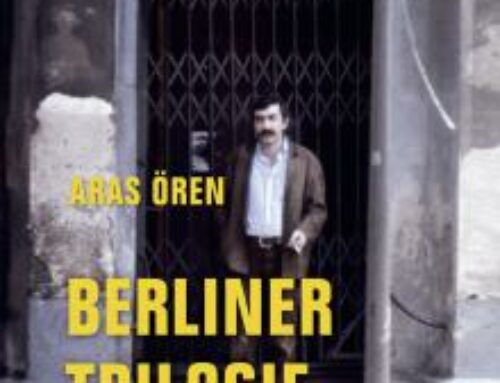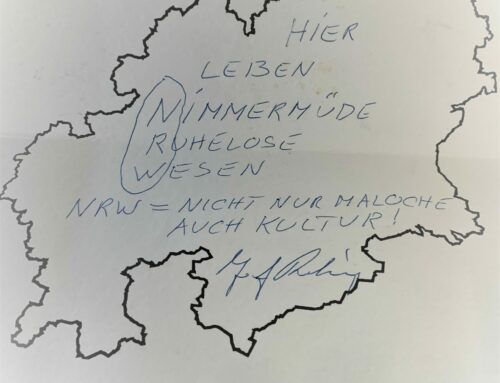Ein Reisetagebuch aus Kirgistan von Norma Schneider
Josef Reding reiste viel und er schrieb über das, was er auf Reisen beobachtete. Zwischen 1959 und 1966 fuhr er durch Asien, Afrika und Lateinamerika und arbeitete dort an den Fernsehdokumentationen Berg der Favelados (1959, 1963), Aufstand der Unbehausten (1962), Hongkong, Insel der Wartenden (1964, 1965), Lepra-Ärztin in Karachi. Ruth Pfau (1964), Missionsstraße Amazonas(1964) und Haus der Sterbenden, Kalkutta (1969). Über die Arbeit als Dokumentarfilmer notiert Reding am 26. Januar 1961 in Mayo-Ouldémé: „Was ist das, ein Dokumentarfilm? – Eine Bild- und Textkomposition, die sachgerechte, möglichst umfassende Kunde von einem Ereignis gibt. Wie man die Kamera auch dreht, die Mitteilung von den Geschehnissen, bei denen man zugegen ist, kann nur bruchstückhaft sein.“
Während seiner Reisen machte Reding Notizen wie diese und veröffentlichte sie später in Buchform. Dabei zeugen seine Texte von einem sehr eigenen Stil der Tagebuchprosa . Die Einträge beschreiben mal empathisch Armut und Hunger, erinnern dann aber wieder an oberflächliche Abenteuerliteratur.
Um an die Idee des Schreibens auf Reisen anzuknüpfen, um hinzuschauen und anderen zu erzählen, was sie gesehen hat, hat die Journalistin und Autorin Norma Schneider ein zeitgemäßes Reisetagbuch für uns geschrieben.
Bischkek, 7. September 2023
Seit einer Woche bin ich jetzt in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgistan. „Kirgistan – ist das in Russland?“ Das wurde ich vor meiner Reise mehrfach gefragt. Ich bin an einen Ort gereist, über den man in Deutschland nicht viel weiß und über den auch ich bis vor kurzem nicht viel wusste. Zwei Monate habe ich Zeit, um mehr zu erfahren über dieses kleine Land in Zentralasien, jener Region, die zwischen Russland im Norden, China im Osten und Afghanistan und dem Iran im Süden liegt. Erst vom russischen Zarenreich kolonialisiert, später von der Sowjetunion. Kirgistan, seit 1991 ein unabhängiger Staat, hat knapp sieben Millionen Einwohner*innen und gefühlt mindestens genauso viele Berge.

Bei meinen ersten Spaziergängen durch die Stadt fällt mir vor allem eines auf: Die Straßen sind mit Autos vollgestopft, die Abgase machen das Atmen für die Katalysator-verwöhnte europäische Lunge schwer. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es hier nur solche, die ebenfalls im Stau stehen: Busse, Marschrutkas (Kleinbusse) und Trolleybusse. Da ist man zu Fuß meist schneller. Immerhin gibt es viele Parks, die einen durchatmen lassen. Was mir sofort gefällt, ist die Architektur. Der sowjetische Einfluss ist unverkennbar, trotzdem sieht es hier nicht aus wie in einer beliebigen postsowjetischen Stadt.
Die Eigenheiten sind deutlich sichtbar und die verschneiten Bergketten, die man selbst vom Zentrum aus sehen kann, geben der Stadt eine besondere Atmosphäre. Deutlich sichtbar sind auch die Kontraste: Gegenüber dem modernen Wohnblock, in dem sich meine Wohnung befindet, steht eine heruntergekommene Garagensiedlung, davor parkt ein alter Lada, der vom Anschauen auseinanderzufallen droht, direkt neben einem nagelneuen Luxusjeep.

Was mir auch sofort auffällt: Häufig sieht man Hinweise auf russische Firmen und Produkte, die meisten Tankstellen in der Stadt sind von Gazprom und Rosneft, ab und an sind sogar russische Flaggen zu sehen. Nachdem ich anderthalb Jahre lang vor allem ukrainische Flaggen habe wehen sehen, ist das ein seltsamer Anblick. Auch die russische Sprache ist hier präsenter als erwartet, überall werde ich auf Russisch angesprochen, in den Restaurants sind die Speisekarten auf Russisch, die Schilder und Aufschriften zweisprachig. Anders als in anderen postsowjetischen Staaten, die ich in den letzten Jahren besucht habe – Georgien und Lettland zum Beispiel – ist hier nichts zu spüren von einer Distanz zu Russland.
Auf Plakaten an einem Bauzaun wird für die luxuriösen Wohnungen geworben, die dort entstehen, das abgebildete Gebäude ist dem stalinistischen Zuckerbäckerstil nachempfunden, der Name des Bauprojekts: MOSKVA. Russland ist hier ein Sehnsuchtsort. Und das auch im ganz praktischen Sinne. In der Nähe des Busbahnhofs gibt es eine Straße, an der sich die Büros von Transportunternehmen aneinanderreihen. Sie alle haben dasselbe im Angebot: von Bischkek nach Moskau per Minibus, bequem, schnell und mit Platz für viel Gepäck. Viele Kirgis*innen gehen als Arbeitsmigrant*innen nach Russland – und werden dort meist ausgebeutet und nicht selten Opfer rassistischer Angriffe.
Bischkek, 15. September 2023
Kirgistan ist bei vielen, die sich zumindest ein wenig mit der Region beschäftigt haben, als „Insel der Demokratie“ in Zentralasien bekannt. Bis vor ein paar Jahren war das auch noch durchaus zutreffend. Mittlerweile sieht die Wirklichkeit allerdings anders aus. Präsident Sadyr Dschaparow betreibt erfolgreich einen autoritären Umbau des Landes. Kritische Medien werden gesperrt, neue Gesetze werden eingeführt, die die Macht des Präsidenten stärken, und seit August ist die Verbreitung von „homosexueller Propaganda“ unter Minderjährigen verboten – ein Gesetz nach russischem Vorbild. Wie Putin nutzt auch Dschaparow das Propagandanarrativ vom westlichen Einfluss, der die traditionellen Werte bedrohen würde. Die LGBTQ-Organisation, bei der ich ein Praktikum mache, während ich hier bin, ist vorsichtig geworden. Sie verzichtet seit Verabschiedung des Gesetzes darauf, Veranstaltungen durchzuführen und Präsenz in den sozialen Medien zu zeigen, um sich nicht zur Zielscheibe für die Behörden zu machen.
Während es in Bischkek nicht viele sichtbare Spuren von Protest und „alternativem“ Leben gibt (Graffiti zum Beispiel), entdecke ich zufällig ganz in der Nähe meiner Wohnung einen der wenigen „alternativen“ Orte der Stadt: Ein kleines unabhängiges Theater in einem Hinterhofkeller. Etwa 25 Zuschauer*innen passen hinein. Ich schaue mir das russischsprachige Stück „Aufführung mit verbotenem Namen“ an. Es handelt von Zensur und den Kampf zweier Sprachen: Die der Kunst und die der Macht. Den Kontext bildete der Besuch Chruschtschows in einer Avantgarde-Ausstellung 1962, wo er die Künstler*innen beschimpfte und sich anschließend darum bemühte, den Einfluss der Partei auf die Kunst zu stärken. Das Stück fängt die damalige Stimmung als spielerische Collage ein und spart nicht mit Bezügen zur aktuellen Situation. Nach der Aufführung sitzen Regisseur, Darsteller*innen und Zuschauer*innen gemeinsam vor dem Theater und trinken Tee, als sich ein Auto nähert. „Jetzt kommen sie uns holen!“, scherzt einer der Schauspieler, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Ernst in seinen Worten steckt.
Karakol, 17. September 2023
Ich bin für ein paar Tage der Stadt entflohen und lasse mich einmal um den Issyk-Kul, den zweitgrößten Bergsee der Erde, fahren. Es gibt Strand und Wellen und endlose Bergketten am Horizont. Auf dem Weg zum See im Nordosten des Landes machen wir einen Zwischenstopp am Konorchek Canyon. Von einem kleinen Schotterparkplatz, den man von der Straße aus leicht hätte übersehen können, laufen wir ein paar Kilometer durch eine malerische Schlucht, bis sich eine Weite aus rotem Sandstein auftut, Felsformationen, wie man sie auf Postkarten aus dem Westen der USA erwarten würde. Ich kann es kaum fassen, wie schön es hier ist, und das in völliger Einsamkeit, ohne jede touristische Infrastruktur, bloß ein unscheinbarer Schotterparkplatz. Nicht mal in meinem Reiseführer wird dieser Ort erwähnt, dabei gehört er zu den beeindruckendstem, die ich bisher gesehen habe.
Natürlich trifft man auch Tourist*innen in Kirgistan – vor allem junge Backpacker und Rentner*innen, die genug Zeit und Geld haben, um mit Funktionskleidung und guter Laune in kleinen Grüppchen um die Welt zu jetten (hier etwas Unvorstellbares, man hat Glück, wenn die Rente für das Nötigste reicht), schätzen Kirgistan für die atemberaubenden Berglandschaften. Aber dafür, wie schön es hier ist, sind es wirklich erstaunlich wenige.

Meine Guides auf dieser Tour sind meine Vermieterin aus Bischkek und ihr Ehemann. Die beiden sind Anfang dreißig, sehr freundlich – und ziemlich konservativ. Sie kommen selbst aus einem Dorf an den Ufern des Issyk-Kul und kennen die Gegend gut. Wir reden viel in den drei Tagen, die wir gemeinsam unterwegs sind, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ganz offen sprechen kann. Bereits auf der Hinfahrt hat meine Vermieterin mir viel vom Präsidenten vorgeschwärmt, von den ordentlichen Straßen, die er baut, von den geplanten Maßnahmen, um die Löhne zu erhöhen. Also sollte ich vielleicht nicht erzählen, dass es mich belastet, hier dem autoritären Staat in Echtzeit beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen. Dass ich mir Sorgen mache wegen der Repressionen, der Stärkung der präsidialen Macht, dem Verbot von Kundgebungen und Demonstrationen.
Als wir irgendwo am Nordufer des Sees in der nebligen Landschaft auf einer Wiese stehen, deren nasses Grün mich an Irland erinnert, und ich nicht aufhören kann, die wolligen Yaks zu fotografieren, erzählt sie mir, dass es in Kirgistan nicht normal wäre, in meinem Alter noch nicht verheiratet zu sein. Hier dürfe man vor der Ehe nur küssen, erst danach dann, um Babys zu bekommen, du weißt schon. Ich beschließe, dieser Frau besser auch nicht zu erzählen, dass ich hier für eine Organisation arbeite, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzt. Jener Menschen, die der Präsident erfolgreich zum Feindbild erklärt hat, weil sie die traditionellen Familienwerte zerstören würden.
Im Siegespark von Karakol steht ein Denkmal, das an den Sieg der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg erinnert – wie in jeder noch so kleinen ehemals sowjetischen Stadt eines steht und entweder restauriert in neuem Glanz erstrahlt oder langsam vor sich hin verfällt. Je nachdem, wie sehr die militärische Stärke der Sowjetunion im jeweiligen Land als Identifikationsmoment oder auch als Propagandainstrument dient. Wenn es nicht, wie unlängst im lettischen Riga, gesprengt wurde, weil man wirklich nichts mehr mit diesen Narrativ zu tun haben will. (Und zwar nicht, weil man es nicht wichtig fände, dass Nazi-Deutschland besiegt wurde, sondern weil die sowjetische Heldenerzählung sich nicht trennen lässt von Imperialismus und Unterdrückung und derzeit Russland als Rechtfertigung für den Krieg gegen die Ukraine dient.) Hier in Karakol befindet sich das Denkmal in mittelmäßigem Zustand. Durchaus gepflegt, wenn auch ein wenig halbherzig, wie es scheint.
Anlässlich der Kriegsthematik fragt mich meine Vermieterin, wen ich denn unterstützen würde, Russland oder die Ukraine. Sie ist nicht überrascht von meiner Antwort, viele Gäste aus Europa würden die Ukraine unterstützen. Sie selbst habe keine klare Meinung, sagt sie, sie kenne sich zu wenig aus. Aber sie habe Angst, dass Russland Kirgistan in den Krieg hineinzieht. Sie will, dass ihre Kinder in Frieden aufwachsen können. Wir einigen uns darauf, dass Herrscher, die, wie Putin, lange an der Macht sind, nicht mehr an die Menschen denken, nur noch an sich selbst. Wir sind glaube ich beide erleichtert, als wir den Park verlassen und das Thema hinter uns lassen. Anschließend gehen wir Ashlan-fu essen, eine kalte scharfe Nudelsuppe, in die ich mich sofort verliebe.

Osch, 2. Oktober 2023
Von Bischkek fährt man etwa 600 Kilometer Richtung Süden, über Passstraßen auf über 3000 Metern Höhe und durch eine Vielzahl verschiedener Landschaften, dann erreicht man Osch, die zweitgrößte Stadt des Landes. Die Hauptsehenswürdigkeit ist der heilige Berg Sulaiman-Too im Herzen der Stadt. Ganze 17 Kultstätten verschiedener Religionen und Zeiten finden sich an seinen Hängen. In eine Höhle in der Felswand ist ein Museum gebaut worden, das die verschiedenen Religionen, deren Spuren sich am Berg finden, vorstellt. Eine junge Frau, vielleicht Anfang oder Mitte zwanzig, führt mich durch die Ausstellung. Anfangs erklärt sie mir alles sehr gewissenhaft, doch nachdem sie mir etwa fünf archaische Riten vorgestellt hat, scheint sie Vertrauen zu mir gefasst zu haben und beendet den Standardvortrag.
Sie zeigt mir eine traditionelle Wiege, wie sie auch heute noch im ländlichen Kirgistan verwendet wird. Ich lobe den sehr schön verzierten Gegenstand, doch sie sagt: „Ach, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe heute einen krummen Rücken, weil ich so lange in diesem Ding liegen musste.“ Und beim nächsten Exponat, der Nachbildung einer kleinen Höhle, in die man sich tagelang zum Schweigen zurückzog, schüttelt sie nur noch den Kopf, sagt: „das muss doch langweilig sein!“, und lacht. Am Ende unseres Rundgangs umarmt sie mich überschwänglich, sagt, wie toll es gewesen sei, mit mir zu sprechen. Dabei habe ich kaum etwas gesagt, war nur da und habe vielleicht einfach nur ausgestrahlt, nicht die größte Freundin religiöser Traditionen zu sein.
Zum Mittagessen gibt es Plow, ein Reisgericht mit Fleisch, Möhren und variierenden weiteren Zutaten, das hier im Süden, in der Nähe zur usbekischen Grenze, ganz besonders gut ist. Zum Abendessen gibt es ebenfalls Plow, und am nächsten Tag auch. Zum Ende der Reise werde ich zu 95 % aus Plow bestehen.
Bevor wir noch weiter Richtung Süden fahren, bitte ich meinen Fahrer, noch kurz am Lenin-Denkmal in Osch zu halten, damit ich ein Foto machen kann. Nicht weil ich Lenin-Fan wäre, sondern weil es für mich als (West-)Deutsche etwas Ungewöhnliches ist, erkläre zur Sicherheit. Tatsächlich lässt sich mein sonst eher schweigsamer Begleiter hier zu einem Kommentar hinreißen: „Bei den ganzen Denkmälern streckt Lenin immer die Hand aus, ich glaube, das tut er, weil er den Leuten immer gezeigt hat, was sie zu tun und zu lassen haben, immer bestimmen wollte. Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich ihn wegräumen lassen.“
Sary-Tasch, 4. Oktober 2023
Als wir gestern am Nachmittag in Sary-Tasch ankamen, war ich sofort überwältigt: Nur ein paar Häuser, nichts Spektakuläres, aber die Kulisse! Der gesamte Horizont wird eingenommen von der beeindruckenden Bergkette des Pamir mit Gipfeln, die 5.000, 6.000 und sogar 7.000 Meter hoch sind. Sary-Tasch selbst liegt auf 3.150 Metern und ich muss mich erst daran gewöhnen, in dieser Höhe zu atmen. Etwa einen Kilometer östlich vom Dorf halten wir an einem Hügel. Der Aufstieg fällt mir schwer, bei der kleinsten Anstrengung habe ich das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Aber wenn man langsam macht, geht es. Und es lohnt sich! Die Aussicht in ein weites Tal aus rotem Staub mit den weißen Bergen im Hintergrund ist einmalig. Die Berge, die ich zu meiner Linken am Horizont sehen kann, gehören zu China, und rechts ist Tadschikistan. Mir wird bewusst, wie weit weg ich von zu Hause bin – und wie sehr mir das gefällt. Ich stehe auf dem Hügel, schaue in die Ferne und atme – schön tief und langsam.
Wir fahren nach Westen, zum Pik Lenin, mit 7.134 Metern der höchste Berg im kirgisischen Teil des Pamir. Teilweise liegt der Berg bereits in Tadschikistan. Offiziell wurde er mehrmals umbenannt, zuletzt in „Pik Abuali ibni Sino“ nach dem persischen Philosophen Avicenna, doch scheinen die meisten weiterhin den griffigeren sowjetischen Namen zu verwenden. Viele Kirgis*innen wollen sich ohnehin nicht mit einem tadschikischen Namen anfreunden, die beiden Nachbarländer sind seit Jahren in Grenzstreitigkeiten verwickelt, man mag sich nicht besonders.
Der Pik Lenin ist einer dieser Orte, die einen für zukünftige Reisen verderben, so schön sind sie. Ich habe unfassbares Glück mit dem Wetter, keine Wolke am Himmel, die Sicht absolut klar. Auf fast 4.000 Metern wandere ich über sandfarbene Hügel an einem Canyon entlang in Richtung des Berges, dessen schneebedeckte Hänge in der Sonne glitzern. Ich glaube, Ehrfurcht ist ein gutes Wort für das, was ich bei diesem Anblick empfinde. Ich möchte mich einfach hier hinsetzen und nur hinstarren auf diese Schönheit. Und genau das tue ich.

Fernstraße EM-04 zwischen Osch und Bischkek, 6. Oktober 2023
Heute sitze ich den ganzen Tag im Auto. Nach der einsamen Berglandschaft geht es zurück in die Großstadt. Während der langen Fahrt komme ich dann doch etwas ausführlicher mit meinem Fahrer ins Gespräch. Er fragt mich, wie die Politiker in Deutschland denn so wären und was Benzin, Gas und Strom bei uns kosten. Er erzählt mir, dass die kirgisische Politik wie eine Soap Opera sei, ständig wird jemand aus dem Amt gejagt, ins Gefängnis geworfen, aus dem Gefängnis befreit, wieder an die Macht gebracht. Und das Zuschieben von Posten und Ämtern unter Freunden und Verwandten sei sowieso gang und gäbe.
Um die Mittagszeit sehen wir viele kleine Kinder entlang der Hauptstraße von der Schule nach Hause laufen, oft in viele Kilometer entfernte Dörfer. Angesichts des Fahrstils vieler Kirgis*innen ist das ziemlich gefährlich, denn einen Fußweg neben der Straße gibt es nur vereinzelt. Meine Russischlehrerin hat mir bei einer unserer Unterrichtsstunden gesagt: „In jedem noch so kleinen Dorf haben sie eine Moschee gebaut, aber Schulen gibt es auf dem Land viel zu wenige. Dabei ist Bildung doch wohl wichtiger als Religion! Zuerst sollte man Schulen und Krankenhäuser bauen, dann von mir aus Moscheen.“ Ich habe nichts hinzuzufügen.
Nachdem wir zum zehnten Mal die Playlist meines Fahrers gehört haben, die aus einer merkwürdigen Mischung aus 90er-Dance-Hits (Nana – „He’s coming“) und russischen Chansons (Michail Krug – „Wladimirski Zentral“) besteht, fragt er mich, ob ich nicht Musik von meinem Handy spielen will. Welche Musik ich denn höre? „Rockmusik“, sage ich vorsichtig. Rock mag er nicht so, aber ich soll mal deutsche Rockmusik anmachen. Ich will erklären, dass ich eigentlich keine Musik mit deutschen Texten höre, aber dann tue ich ihm den Gefallen und wir brausen zu den Toten Hosen durch das malerische Tal des Naryn-Flusses.
Dann ist das Internet weg und ich gebe zu, dass ich meine Lieblingssongs heruntergeladen habe, ob ich die vielleicht anmachen soll? Aber ich könne für nichts garantieren! Mein Fahrer stimmt begeistert zu, so schlimme Sachen werde ich schon nicht hören. Als das dritte Lied einer russischen Exil-Band mit sehr deutlich kritischem Text beginnt (Pornofilmy – „Eto proidjot“), ist es mir doch etwas peinlich.
„Wenn ich russische Musik höre, dann meistens oppositionelle Bands, das finde ich interessant“, sage ich vorsichtig. Der Fahrer nickt, findet es wohl auch interessant. Putin mag er auch nicht sehr, sagt er. Was ich über den Krieg denke? Jetzt ist eh alles egal, denke ich. Also bin ich deutlich, verurteile die russischen Kriegsverbrechen und sage, wie irre es doch sei, dass ein so riesiges Land wie Russland einen Eroberungskrieg um Territorium führt. Dass Putin wohl das sowjetische Imperium zurückhaben möchte. Und dafür sollen Menschen sterben? Mein Fahrer nickt, das sehe er schon ganz ähnlich. Nur dass man auch bedenken müsse, dass in der Ukraine eigentlich die USA gegen Russland kämpfe – was zwar auch eine Propagandaerzählung ist, aber eine, die schließlich auch munter von vielen deutschen Linken wiederholt wird. Ich finde seine Position recht bemerkenswert in diesem Land, wo der russische Einfluss so stark ist, wo das Fernsehen von staatlichen russischen Sendern dominiert wird und deshalb die Zustimmung zu Russland außerhalb der jungen kreativ-alternativen Großstadt-Bubble ziemlich groß ist.
Eine Stunde vor Bischkek – wir hören mittlerweile eine Playlist kirgisischer Popmusik, die mein Fahrer auf Youtube gefunden hat – stellt er mir dann endlich die unvermeidliche Frage, die ihm wohl schon länger auf der Seele brannte: „Und, wann heiratest du?“
Bischkek, 12. Oktober 2023
Etwas ist heute anders, als ich durch die Innenstadt gehe, vorbei an Universitätsgebäuden bis zur imposanten Philharmonie. Ich realisiere: Der Lärm ist weg, und die Abgase auch. Keine Autos verstopfen die Straßen, man kann in Ruhe spazieren. Wenn da nicht die vielen Polizisten wären, die alle paar Meter am Straßenrand postiert stehen, ein Anblick, der einen in einem autoritären Staat noch mal extra nervös macht.
Dann fällt mir wieder ein, was heute für ein Tag ist. Wladimir Putin ist auf Staatsbesuch in Kirgistan, ich habe es wohl nur knapp verpasst, ihn vorbeifahren zu sehen. Viele Freunde hat der russische Präsident nicht mehr und es gibt auch nicht mehr viele Orte, an die er reisen kann, ohne seine Verhaftung fürchten zu müssen. Hier wurde er freundlich empfangen.
Gestern war internationaler „Coming-Out-Day”, ein Tag, der der Unterstützung queerer Menschen gewidmet ist, sie ermutigen soll, zu ihrer Sexualität und Geschlechtsidentität zu stehen. Auch in einem der wenigen Safe-Spaces für die queere Community in Bischkek wurde dieser Tag gefeiert, junge Menschen aus der Community kamen zusammen, um ihre Geschichten zu erzählen. In Kirgistan gehen viele nicht offen mit ihrer Identität um, weil sie Ablehnung, Diskriminierung und teilweise auch Gewalt zu befürchten haben. Gleichzeitig ist die Angst vor Outings groß, also davor, dass jemand von der queeren Identität einer Person erfährt und diese öffentlich macht, zum Beispiel vor der Familie, dem Arbeitgeber oder in den Sozialen Medien. Outings werden von staatlichen Behörden gezielt eingesetzt, um Aktivist*innen zu diskreditieren oder Geld zu erpressen.
Auch in der einzigen Gay-Bar Kirgistans stand schon öfter die Polizei vor der Tür, drohte der Inhaberin mit Schließung und verlangte Geld. Doch die Bar, die eigentlich eher ein Club ist, hält sich trotz allem schon seit einigen Jahren wacker.
Am Samstag war die Stimmung gut, leckere Drinks, laute Musik, viele tanzende junge Leute, auch nicht anders als in Europa. Bis auf ein paar kleine Details: Am Eingang hängt kein Schild, die Adresse des Clubs ist nicht öffentlich bekannt, überall sind Hinweise angebracht, dass Fotografieren und Filmen verboten ist, und am Einlass wird man befragt, ob man weiß, was das für eine Bar ist. Männer werden auch nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt, heterosexuelle cis Männer sind nicht gerne gesehen, denn der Club soll auch ein Safe-Space für Frauen sein, in dem sie keine Anmache und Belästigung zu befürchten haben, erzählt mir die Inhaberin.
Orte wie diese sind kleine Inseln der Freiheit in einem autoritärer werdenden Staat, in dem es gefährlich ist, sichtbar queer zu sein. In einem Land wie diesem können solche Inseln ein Lebensretter sein, weil manche Menschen sonst keinen Ort hätten, an dem sie sie selbst sein können.
Bischkek, 25. Oktober 2023
Das lange Befürchtete ist eingetreten: Ohne jegliche Diskussion hat das Parlament heute den Gesetzentwurf über „ausländische Agenten“ in erster Lesung angenommen. Das von Russland inspirierte Gesetz ist eine Katastrophe für die Zivilgesellschaft. Es zielt vor allem auf NGOs ab, die die Finanzierung aus dem Ausland erhalten – und das sind eigentlich alle Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen. LGBTQ-Organisationen könnte es ohne Geld aus dem Ausland hier gar nicht geben. Nun müssen sich betroffene NGOs als „ausländische Agenten“ registrieren und werden streng kontrolliert. Außerdem soll ein neuer Artikel ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden: Wenn jemand eine NGO gründet oder mit ihr kooperiert, die „die Persönlichkeit oder die Rechte der Bürger verletzt“, drohen bis zu zehn Jahre Haft. Was genau es bedeutet, die „Persönlichkeit oder die Rechte der Bürger“ zu verletzen, ist nicht definiert. Es ist ein Freibrief für Repressionen.
Die Stimmung in der NGO, für die ich gerade arbeite, ist entsprechend gedrückt. Man weiß nicht, wie es weitergeht, ob man wird weitermachen können. „Es sind dunkle Zeiten“, sagt mir eine Aktivistin.
Derweil sind die Nachrichten voll mit einem anderen Thema: Der Präsident möchte die Nationalflagge ändern lassen. Die Flagge Kirgistans ist rot mit einem gelben Tündük (die Krone einer traditionellen Jurte) im Zentrum. Um den Tündük sind 40 Sonnenstrahlen für die 40 Stämme der Kirgisen zu sehen. Bisher waren die Strahlen wellig, nun sollen sie gerade werden, um „Fehlinterpretationen zu vermeiden“, heißt es in einem offiziellen Statement, schließlich sei die Flagge ein wichtiges nationales Symbol, das die Unabhängigkeit des Staates betont. Meine Russischlehrerin hat dazu auch ein Statement abgegeben: „Die Leute hier können kaum von ihrer Rente leben, aber wir geben Geld dafür aus, die Flagge zu ändern, da kann man eigentlich nur noch drüber lachen.“
Es ist bizarr. Politisch passiert so viel Furchtbares, gleichzeitig ist davon im Alltagsleben nichts zu spüren. Die Leute gehen weiter spazieren und einkaufen, sitzen in den Cafés und Parks, als wäre nichts. Und wahrscheinlich ist es für viele auch „nichts“, weil sie nicht betroffen sind, weil Politik ihnen egal ist. Auch ich habe das Privileg, nicht betroffen zu sein. Ich bin nur zu Gast und weiß, dass ich bald wieder zurück in Deutschland sein werde. Wo mir der Rechtsruck und der wachsende Antisemitismus zwar auch Angst machen, wo aber weder queere Menschen von staatlichen Behörden verfolgt noch Medien und NGOs mundtot gemacht werden. Und so kann ich es mir hier einfach gutgehen lassen, in Ruhe meinen Sanddorntee trinken, mir in den Cafés den Bauch vollschlagen mit all dem guten Essen, ins Kino und ins Theater gehen, mir die Nägel machen lassen. Ist schließlich alles so schön günstig hier (wenn man Euros verdient).
Für viele hier ist es ebenso gut möglich, einfach auszublenden, was passiert. Sie entscheiden sich, nicht die Nachrichten zu lesen, sondern den Alltag zu leben. Vielleicht wird kurz beim Friseur über die Änderung der Nationalflagge diskutiert, weil man das doch irgendwie mitbekommen hat, aber das war’s dann auch schon mit den politischen Themen.
So funktionieren autoritäre Staaten: Nicht nur mit Angst, sondern auch dank Verdrängung und Desinteresse. Dank des letztendlich auch verständlichen Wunsches, sich nicht mit schlechten Nachrichten zu belasten.
Und dann sind da diejenigen, die es sich nicht aussuchen können, ob sie sich mit der politischen Lage beschäftigen oder nicht. Weil sie selbst betroffen sind, weil sie es sind, die diskriminiert und verfolgt werden. Ihretwegen will ich tun, was ich kann: Hinschauen und anderen erzählen, was ich gesehen habe.
Über die Autorin:
Norma Schneider ist freie Journalistin, Autorin und Lektorin aus Frankfurt am Main. Sie schreibt für verschiedene Medien über Kultur, Gesellschaft, Protest und die LGBTIQ*-Community in Osteuropa, Russland und Zentralasien. Ihr Buch „Punk statt Putin. Gegenkultur in Russland“ ist 2023 im Ventil Verlag erschienen.