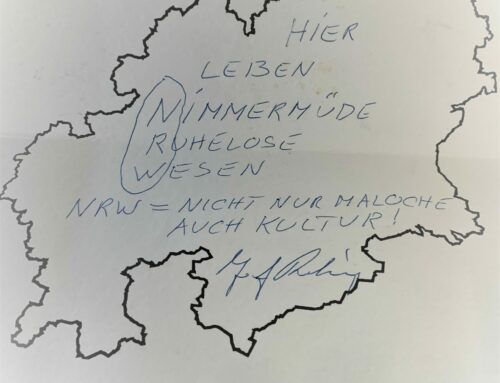von Aras Ören
Und da war am Anfang ein Gedicht:
Aras, jeden Abend kommst Du
so wie eine müde Pappel von der Arbeit
Deine hängenden Bartzipfel
zwei Untergrundkämpfer
in stummer Revolution
Du Reicher von gestern
dem seine Piratenschiffe abhandenkamen
Dem Dichter, der diese Zeilen schrieb, verpassten selbsternannte Kenner der Materie zugleich ein Etikett: So wie es auch auf Marmeladengläsern zu finden ist: Auf dem Etikett stand „Gastarbeiter“. Ich mochte dieses Wort von Anfang an nicht. Das Wort ist ein Anonymmacher, voller verdeckter Erniedrigung. Es fängt Menschen ein, macht sie unsichtbar und erklärt sie für nichtig. Das Wort bringt die Menschen nicht zusammen, es trennt sie. Es ist voller bitterer Essenz. „Du Gastarbeiter komm! Du Gastarbeiter geh“. Die so Gerufenen verstanden am Anfang nicht einmal den Inhalt und hätten sie es verstanden, so hätten sie es nicht ernst genommen.
Ich erinnere mich an ein in Deutschland entstandenes türkisches Lied, das damals gern gesungen wurde und einiges verständlich macht: „Allemania, Alamania-Benden enayi bulamania…“ („Deutschland, Deutschland, Du kannst keinen dümmeren Menschen finden als mich…“) Es zu singen, war eine Seelenmassage. Eine Katharsis. Diejenigen, die das sangen, hatten keine Sprache.
Also schrieb ich für sie. Und plötzlich gab es Gesichter, Namen, Menschen. Das ist die Kraft des Wortes. Das vermag die Literatur.
Die Lösung unserer Probleme ist mit den hiesigen Klischeevorstellungen unmöglich. Wir leben in einer hochentwickelten Industriegesellschaft in Europa, aber mit unserem eigenen Charakter, mit unserer Geschichte und Kultur (und nicht mit blonden Haaren und Goethes „Faust“ unter dem Arm.) Max Frisch schrieb: „Wir haben Arbeitskräfte gerufen und es sind Menschen gekommen.“
Ja, Menschen mit eigenem Namen, eigenem Glauben, einer bäuerlichen Kultur. Erst hier sind sie namenlose, gesichtslose Arbeiter geworden.
Für ihre Landsleute in der Türkei blieben sie immer Bauern. Aber heute möchten einige daheim gebliebene Türken mit den damaligen „Gastarbeitern“ den Platz tauschen. Doch früher hieß es über die mit schweren Holzkoffern und Plastiksäcken bepackten Landsleute an deutschen Bahnhöfen naserümpfend: Die liefern ein völlig falsches Bild von uns Türken. Aus einem Bauer wird nie ein Mensch. Das sagten die, bei denen Eltern oder Staat ein Studium finanzierten.
Von 1950 an gab es in der Türkei größere Veränderungen, die sowohl struktureller wie auch sozialpolitischer Natur waren. Die Veränderungen machten sich in jeder Gesellschaftsschicht bemerkbar. Zuerst langsam, ab 1960 immer unaufhaltsamer. Sie stürzten das Land in eine Überlebenskrise bis an die Schwelle des Zerfalls, denn zur wirtschaftlichen Inflation gesellte sich die Auflösung der Werte. Nicht nur die Türkei machte diesen Wandel durch, auch in den hochentwickelten Industrieländern, in denen das Wirtschaftswachstum nie gekannte Ausmaße annahm, mussten im Zuge einer weltpolitisch zu steuernden Konjunkturflaute Strategien aufgegeben und neue Wege gefunden werden. Diese Veränderungen ergriffen das Bewusstsein vieler Menschen.
Hierzu passt ein Gedicht aus dem Buch „Meine recht großen Augen“ (1964):
Ein hässlicher Mond kommt herauf
– eine schreckliche Nacht –
aus den Teichen springen die Fische
das Meer ergießt sich in den Wald
Von Unterbrechungen abgesehen, arbeitete ich zehn Jahre lang am Theater. Wir wollten das herkömmliche türkische Theater verändern. Die Theaterleute meiner Generation waren damit auf ihre Weise erfolgreich. Sie richteten das Theater zugrunde. Erfolgreich waren auch tonangebende Vertreter einer provinzlerischen, nachäffenden Bourgeoisie, die ihren seichten Geschmack und ihre Profitsucht als Maxime durchgesetzt hatten. Ich war unzufrieden.
Wir waren eine Generation ohne Identität. Was der Westen über Jahrhunderte hinweg und Klasse auf Klasse als Kulturleistung geschaffen hatte, infizierte uns, stand aber in keinerlei Beziehung zu unserem Leben. Gleichzeitig stieß uns die degenerierte, verlogen-traditionalistische oder den Westen imitierende Kultur unseres eigenen Lebenskreises ab.
Ich packte meine Sachen und fuhr nach Berlin. In die Stadt, die ich schon einmal vagabundierend durchstreift hatte. Diesmal jagte Berlin mir bei meinem neuerlichen Kommen Angst und Schrecken ein. Ich erhielt eine Lochkarte und fand mich als Hilfsarbeiter in einer Fabrik.
Mein Lebensgefühl – und wohl auch das vieler Gastarbeiter in dieser Zeit – beschrieb ich in folgendem Gedicht:
Der Mann, der Europa veränderte
Wegweisersprüche hörte man aus seinem Munde nie,
nie sah man seine Faust geballt,
verführen ließ er sich auch nicht von schönen Worten,
grub tief die Hände in die Taschen.Im Knopfloch steckte nur noch eine rote Nelke,
verwelkt, Relikt von einem ersten Mai,
an einer Mauer aufgespießt, zahllose seiner Schreie,
die immer noch zu sehen sind.Weit weg der Weg, nächtelang schlaflos,
gerahmtes Bild,
bestehend aus unharmonischen Elementen,
wer weiß, wer es malte.Auf diesem Bild, das ihm durchaus nicht ähnelte,
sah man sein lachendes Gesicht,
das ihn und jeden anderen Betrachter täuschte,
und ölverschmiert war seine Arbeitskleidung.
Der Mann, dem im Knopfloch die rote Nelke vom 1. Mai verwelkte, schreibt über diese „Gastarbeiter“, seine Arbeitskollegen. Die sind jetzt nicht mehr gesichts-, namenlos und identitätslos. Das über sie Geschriebene verschafft ihnen einen Raum in der Geschichte.
Die dritte, auch die vierte Generation der Arbeitsmigranten und -migrantinnen, die Anwälte, Ärztinnen, Döner-Buden-Besitzer, Kindergärtnerinnen, Gemüsehändler, Mitglieder des Parlaments und Fabrikanten geworden sind, werden sich nicht für Eltern, Groß- und Urgroßeltern schämen und die eigene Herkunft vertuschen. Aber sie werden die Demütigung ermessen können, mit der ihre Vorfahren lebten:
Wenn sie sagen: „Hey Du, komm mal her“, komme ich. Ich komme auch dann, wenn ich die Worte „Hey Du, komm mal her“ nicht verstehe. Wenn sie sagen „Hey Du, geh!“, gehe ich. Ich gehe auch dann, wenn ich die Worte „Hey Du, geh!“ nicht verstehe.
Ich bin sicher: die Kinder und Enkel dieser Arbeitsmigranten werden nichts dramatisieren. Sie werden, wie die junge Emine in meinem Buch „Die Fremde ist auch ein Haus“ (der dritte Band meiner Berliner Trilogie) ihre eigenen Schlüsse ziehen. Emine schrieb an den türkischen Generalkonsul in Berlin und an den Berliner Innensenator:
Sehr geehrte Herren,
(…) Weil ich im Paß meines Vaters stehe,
passiert mir alles, was meinem Vater passiert,
von der Steppe angefangen, die er hinter sich herschleift,
seit nämlich (wie ein Mann im Flugzeug erzählte)
zu Ende der fünfziger Jahre ein Bagger in die Steppe
kam und anfing, den Boden aufzuwühlen.
Hinter dem Bagger erschien eine Straße, die Fremde begann.
Die Fremde begann schon in der Heimat, aber mein Vater
nannte sie »Deutschland«.
Ich nenne sie jetzt »Türkei«.
Als ich herkam, war ich fünf Jahre alt.
Seit zehn Jahren bin ich hier, meine Brüder
sind in Berlin geboren.
Wo ist jetzt meine Fremde, wo meine Heimat?
Die Fremde meines Vaters ist meine Heimat geworden.
Meine Heimat ist die Fremde meines Vaters.
Streichen Sie bitte meinen Namen
im Paß meines Vaters.
Ich möchte einen eigenen Paß in der Tasche haben.
Wer mich danach fragt, dem will ich
ehrlich sagen, wer ich bin,
ohne Scham, ohne Furcht
und fast noch ein bißchen stolz darauf.
Das Jahrhundert, in dem ich lebe,
hat mich so gemacht:
geboren 1963 in Kayseri,
Wohnort: Berlin-Kreuzberg.Emine
2019 ist meine „Berliner Trilogie“ erneut verlegt worden. Genau 46 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes. Im Vorwort steht:
Ich widme diese neu verlegte, jetzt 46 Jahre alte Trilogie der ersten und zweiten Generation von Menschen aus der Türkei. Sie haben einen unvergesslichen Anteil an unserem heutigen Wohlstand und kulturellem Reichtum. Und nicht zuletzt waren sie ein historischer Prüfstein unserer Demokratie und Toleranzfähigkeit.
Wir sollten diesen bescheidenen Menschen dankbar dafür sein, dass sie frischen Wind in unsere alte, europäische Kulturlandschaft gebracht haben. Sie änderten sich selbst und Europa. Sie förderten – ohne es zu wissen – einen neuen, europäischen Humanismus.
Ihre Kinder sind längst Europäer geworden. Ihnen mag die Trilogie dabei helfen, der Geschichte ihrer Väter und Mütter näherzukommen und sie vor dem Vergessen zu bewahren. Denn auch in der Gegenwart steckt die Vergangenheit und die Zukunft.
Ja, die Fremde ist auch ein Haus. Oder soll zu einem Haus werden. Einwanderungsbewegungen gibt es seit Menschengedenken, manchmal schneller und intensiver, manchmal langsamer. Die Welt ändert sich eben.
Einst träumte der aristokratische Goethe von einer die Welt verbindenden Literatur.
Ich träume von einer Weltkultur, in der sich die Menschen gegenseitig achten. Dafür brauchen wir Regeln. Es sind heute die Wanderbewegungen, die neue Schattierungen schaffen. Aus dem Orient kommend, aus Afrika wanderten die Menschen auf Autobahnen Richtung Europa, Richtung Deutschland, das Handy und damit die ganze Welt in der Hand.
Diese Menschen waren vollgesogen mit den Versprechungen von Demokratie und Menschenrechten. Sie fühlten sich frei, frei von 200 Jahre alten Gesetzen und Moral.
Nun musst Du Europa, Du Deutschland, damit umgehen. Das erfordert ein neues Denken. Die Welt neu gestalten mit und für all jene, die schon da waren und die dazugekommen sind. Deutschland, Du sollst mit uns auf Deine Einwanderer stolz sein.
Und Deutschland: dafür darfst Du bleiben, wie Du bist: souverän, respektvoll und großzügig in Sachen Toleranz. Deutschland, wir sind auch stolz auf Dich.
Über den Autor:
Aras Ören wurde am 1. November 1939 in Istanbul geboren. Er arbeitete als Schauspieler und Dramaturg an verschiedenen Bühnen. Seit 1969 lebt er in Berlin. Er war Redakteur des SFB und Leiter der türkischen Redaktion von Radio Multikulti des RBB. Ören schreibt auf Türkisch und arbeitet bei der Übersetzung seiner Werke ins Deutsche mit.
Im Verbrecher Verlag erschien 2014 der Erzählungsband „Kopfstand“, 2016 das Lesebuch „Wir neuen Europäer“, beide mit Illustrationen von Wolfgang Neumann. 2020 wurde „Berliner Trilogie“ bei den Lyrik-Empfehlungen aufgenommen.