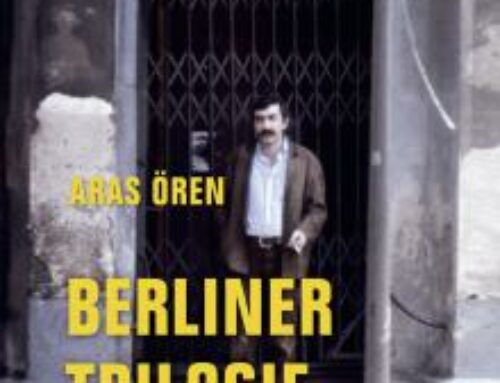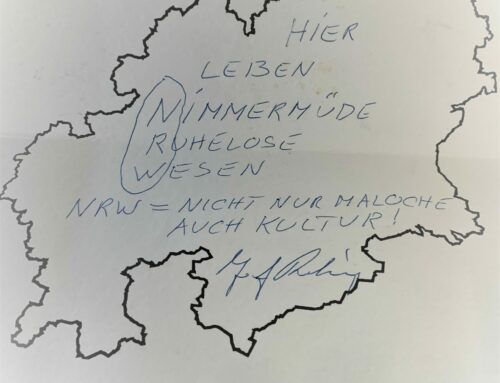Zu Josef Redings Literarisierung der race relations in den USA (und anderswo)
von Stefan Hermes
Vorab: Josef Reding hat in seinen Texten häufig das N-Wort benutzt. In diesem Text wird das Wort ausgeschrieben zitiert.
Repräsentation und Perspektive
Speziell vor dem Hintergrund der Geschichte von Sklaverei, Kolonialismus und Rassismus besitzt die Frage, welche Schwierigkeiten sich ergeben (können), wenn ,weiße‘ Schriftsteller:innen ,schwarze‘ Figuren entwerfen – und dabei auch deren Innenleben zur Darstellung bringen –, erhebliche Relevanz. [1] Zugleich liegt auf der Hand, dass eine derart komplexe Frage an dieser Stelle schwerlich erschöpfend zu beantworten ist. Festhalten lässt sich aber immerhin, dass es grundlegenden Prinzipien der (fiktionalen) Literatur zuwiderliefe, a priori jegliche Form des benannten Repräsentationsverhältnisses für inakzeptabel zu erklären (vgl. Hermes 2016: 179–181) – was nicht bedeutet, dass entsprechende Positionierungen keinen Respekt verdienen. Für weitaus angemessener erachte ich, und hier geht es tatsächlich um eine individuelle Wertentscheidung, jedoch das, was Dirk Göttsche (2010: 230) in diesem Zusammenhang bemerkt hat: Seiner Einschätzung nach können
„Darstellungen afrikanischer Perspektiven auf die Kolonialgeschichte […] auch dann zur postkolonialen Bewusstseinsbildung beitragen […], wenn sie auf der Ausgestaltung afrikanischer Figuren durch (weiße) deutsche AutorInnen beruhen. […] Umgekehrt bietet die literarische Arbeit mit […] Stimmen des kolonialen ,Anderen‘ zwar die Möglichkeit, aber keineswegs die Gewähr für die Vermeidung neuerlicher Stereotypisierung und Vereinnahmung.“
Zudem erscheint es plausibel, Göttsches Befund auf jenes Phänomen zu übertragen, das im Folgenden im Zentrum des Interesses stehen wird, nämlich die Schaffung afroamerikanischer Figuren mitsamt ihren Wahrnehmungen, Gedanken, Emotionen usw. durch einen ,weißen‘ deutschen Schriftsteller.
Beobachtung und Literarisierung
Eine gewisse Sonderstellung kam dem 1929 geborenen Josef Reding unter den deutschsprachigen Autor:innen seiner Generation insofern zu, als er relativ gut mit der US-amerikanischen Kultur und Gesellschaft vertraut war. Dies lag weniger daran, dass er 1945 einige Monate als Kriegsgefangener in den Vereinigten Staaten verbracht hatte; entscheidend war vielmehr sein Studienaufenthalt an der University of Illinois in Urbana in den Jahren 1953 und 1954. Vor allem mit Angehörigen der ,schwarzen‘ Bevölkerung unterhielt Reding zu dieser Zeit enge Beziehungen, lebte er doch – die Formulierung entstammt einer offiziösen Kurzvita – in einer „Wohngemeinschaft mit Farbigen“, wodurch auch sein „Engagement in der beginnenden Bürgerrechtsbewegung“ (O. V. 1979: 15) befördert wurde. [2] Für die interkulturelle Dimension seines Werks sind darüber hinaus jene Reisen von Belang gewesen, die ihn in etliche Staaten der ,Dritten Welt‘ führten.
Es ist also kaum zu bezweifeln, dass die vielfältigen „Beobachtungen“, die Reding „zunächst in den USA, später in zahlreichen anderen Ländern“ machte, maßgeblich zu seinem „Eintreten gegen jede Art von Diskriminierung und für die Achtung der Menschenrechte“ beigetragen haben: Diesbezüglich ist Joachim Wittkowski (o. J.) unbedingt beizupflichten. [3]
Allerdings sollte ebenso betont werden, dass sich gerade Redings literarischer Einsatz für die Anliegen von Afroamerikaner:innen aus heutiger Sicht – wenngleich nicht nur aus heutiger Sicht – keineswegs vollkommen unproblematisch ausnimmt. Das hängt einerseits mit seiner fortwährenden Verwendung des N-Worts (teils in der besonders krassen Variante) zusammen, andererseits mit bestimmten narrativen Techniken, sei es im Bereich der Figuren- oder der Plotkonstruktion, sowie mit dem Umstand, dass man sich bisweilen eine intensivere textinterne Reflexion dieser Techniken in poetologischer wie in ethisch-politischer Hinsicht wünschen mag. [4] Demgemäß hat schon Kyra Palberg (o. J.) mit Recht darauf hingewiesen, wie häufig das Schicksal von Redings ,schwarzen‘ Figuren durch einen white savior bestimmt wird, da sie selbst über keine nennenswerte agency verfügen. [5]
Kurzum: Eine Beschäftigung mit Redings Literarisierung der race relations in den USA (und anderswo) sollte respektvoll, aber nicht rückhaltlos affirmativ vonstattengehen, und mithin ist es durchaus erstrebenswert, die blinden Flecken und die Aporien seines Schreibens zu registrieren – und dadurch eventuell auch auf prekäre Implikationen der eigenen Perzeptionsmuster aufmerksam zu werden. Dies gilt unabhängig davon, dass der vorliegende Aufsatz sein Thema lediglich kursorisch wird erörtern können. Zu hoffen wäre, dass sich daraus Anstöße zu einer gründlicheren Auseinandersetzung mit einigen der im weiteren Verlauf nur zu streifenden Erzählungen ergeben.
Geschichten und Stories
Redings literarischen Durchbruch markiert jener (zum Teil in den USA entstandene) Band, der 1957 unter dem provozierenden Titel nennt mich nicht nigger im katholischen Paulus Verlag in Recklinghausen erschien, in dem später auch Max von der Grün und Günter Wallraff publizieren sollten. Der lapidare Untertitel lautete schlicht geschichten; von 27 geschichten ist allein auf dem von Horst Rumberg gestalteten Schutzumschlag die Rede. Mehrere, zum Teil leicht
veränderte Nachauflagen folgten bis 1968.
Indes brachte der Freiburger Herder Verlag schon 1962 eine nahezu identisch betitelte Sammlung von Erzählungen Redings heraus:
Auf die (pseudo)avantgardistische Kleinschreibung verzichtete man hier allerdings, und dem Titel wurde ein Ausrufezeichen hinzugefügt. Als Untertitel wählte man Stories, was offenkundig dazu diente, den ,amerikanischen‘ Charakter der an die Tradition der short story anknüpfenden Geschichten hervorzukehren. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich der Textbestand des Taschenbuchs gravierend von demjenigen von nennt mich nicht nigger unterscheidet: Nur 15 Geschichten wurden daraus übernommen (und anders angeordnet); die übrigen 15 entstammen Redings 1958 bei Paulus erschienener Anthologie wer betet für judas?.


Noch unübersichtlicher stellt sich die Lage deshalb dar, weil der Recklinghäuser Georg Bitter Verlag, das Nachfolgeunternehmen von Paulus, 1978 den (Hardcover-)Band Nennt mich nicht Nigger, nun wieder ohne Ausrufezeichen, veröffentlichte. Der Untertitel Kurzgeschichten aus zwei Jahrzehnten indiziert bereits, dass dieser sehr viel umfänglichere Band nicht bloß Texte aus nennt mich nicht nigger (nämlich 11) und wer betet für judas? (20), sondern auch aus weiteren Sammlungen enthält: [6]
Viele Erzählungen haben allerdings, wie der Autor in einem knappen Vorwort bemerkt, „Straffungen“ (Reding 1978: 8) und sonstige Änderungen erfahren. In den folgenden Jahrzehnten gelangten diverse Lizenzausgaben von Nennt mich nicht Nigger auf den Markt, zuletzt, im Jahr 2020, diejenige des Essener Klartext Verlags (in der Reihe Bibliothek des Ruhrgebiets der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung). [7]


Geschichte und Gegenwart
Die folgenden Überlegungen beziehen sich vorwiegend, aber nicht ausschließlich auf Texte aus den oben genannten Anthologien; einen geeigneten Ausgangspunkt für diese Überlegungen bildet das schon erwähnte, Mein Bekenntnis zur Kurzgeschichte überschriebene Vorwort, das Reding für die Sammlung von 1978 verfasste. Darin unterstreicht er zunächst, wie stark ihn die short story beeinflusst habe:
„Als 16jähriger hatte ich diese literarische Form zum erstenmal kennengelernt: bei den amerikanischen Soldaten, die mich gefangennahmen. Sie hatten Zeitschriften und Taschenbücher mit Stories von OʼHenry, Hemingway, Saroyan und Caldwell dabei […] und überließen mir ihre Lektüre. Mich begeisterte die Ökonomie der Kurzgeschichte, die Einfachheit, die Klarheit der Sprache.“ [8]
Bedeutsamer ist jedoch im Kontext dieses Beitrags, wie Reding den Titel seines Bandes kommentiert. Dieser wurde offenbar schon in den 1950er Jahren als anstößig empfunden, was mit dem enormen Verletzungspotential des N-Worts allerdings gar nichts zu tun hatte: Als ein Affront sei der „angreiferische Titel“ etwa von den „Herren Verlagsvertreter[n]“ deshalb begriffen worden, weil die Deutschen angesichts ihrer „eigenen Probleme […] nicht noch mit denen der Neger bepackt […] werden“ (ebd.: 6f.) sollten. Eine solche Auffassung aber weist Reding als schier unerträglich zurück, zumal er aufgrund kollektiver wie individueller Erfahrungswerte einen Zusammenhang zwischen der jüngeren deutschen Geschichte und der Situation der Afroamerikaner:innen zu erkennen meint:
„Ich gehöre einer Generation an, die vier Jahre alt war, als Hitler zur Macht kam, und die sechzehn Jahre alt wurde, als der Diktator Selbstmord beging. Wir waren zu jung, um für das Emporkommen dieses Mannes verantwortlich zu sein. Aber wir waren alt genug, um bewußt die Verfolgung von Mitmenschen um ihrer Abstammung willen erlebt zu haben.
Wir klagten unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Geistlichen an, als wir aus den Lagern nach Hause kamen. Wir klagten die Älteren an, weil sie geschwiegen hatten, als in ihrer Nähe Menschen um ihrer Rasse willen, unterdrückt, verschleppt, gequält und getötet wurden. Diese Anklage war lautstark und selbstsicher.
Wenige Jahre später kam ich als Fulbright-Student in die USA. Und jetzt wurden in meiner Umgebung Menschen wiederum aus rassistischen Gründen wie ,underdogs‘ behandelt. Und ich wußte, daß meine Anklagen von 1945 nichtig waren, wenn ich jetzt nicht handeln, Flagge zeigen würde.
Vor dem Hintergrund dieser Solidarität mit den Farbigen ist der Titel Nennt mich nicht Nigger konkret gemeint. Aber es wäre ein Mißverständnis, wollte man ihn nur auf die Situation der rassischen Minderheiten in den USA beziehen. Der Titel steht auch für andere Mitmenschen, die um ihrer Rasse, ihres politischen Bekenntnisses, ihrer Herkunft, ihrer Religion willen verfolgt werden.“
Während Redings einleitende Selbstexkulpation nachvollziehbar anmuten mag, frappiert es denn doch, dass er seine Mitwirkung an Protestaktionen der US-Bürgerrechtsbewegung gleichsam als nachgeholten Widerstand gegen den Nationalsozialismus konzeptualisiert. [9] Damit ist keineswegs gesagt, dass es nicht ebenso legitim wie sinnvoll sein kann, verschiedene Formen politischer Unterdrückung in Relation zueinander zu setzen. Dabei aber sollte idealiter ein höherer Differenzierungsgrad erreicht werden, als es bei Reding der Fall ist: Mehr als heikel wirkt dessen mangelnde Unterscheidung zwischen dem rassistischen Terror in den Vereinigten Staaten und demjenigen des ,Dritten Reichs‘ vor allem angesichts der Shoah. Doch auch der folgende Vergleich entfaltet, da er nicht näher ausgeführt und reflektiert wird, nur geringe Überzeugungskraft: „Die menschenunwürdige Behandlung eines Gastarbeiters bei uns wiegt nicht leichter als die Diskriminierung von Farbigen in anderen Regionen.“ (Ebd.)
Mit derartigen, letztlich unterkomplexen Verlautbarungen korrespondiert jenes Credo, das Reding (ebd.: 8) an den Schluss seines Vorworts gestellt hat: Es könne keinen Zweifel geben, „daß der Sprachlose des Sprechers bedarf“ – was offenbar impliziert, dass er seine Aufgabe als Schriftsteller darin sieht, sich als ein solcher (Für-)Sprecher zu betätigen. [10]
Damit aber ignoriert er die zahlreichen Fallstricke, die jedes „Voicing the Other“ (Göttsche 2013: 227) zwangsläufig mit sich bringt. [11] Dazu fügt es sich, dass Reding (1978: 7) seine Erzählungen schon deshalb als besonders realitätsnah verstanden wissen will, weil sie eben auf biographischen Erfahrungen fußen: „Die Titelgeschichte und die meisten anderen Texte […] habe ich in den USA geschrieben, im Zusammenleben mit Farbigen.“ (Ebd.)
Die Tatsache, dass auch der Begriff ,Farbiger‘ bzw. colored – im Gegensatz zu person of color – seit geraumer Zeit als racial slur gilt, legt es nahe, noch einmal auf die Titel von Redings Anthologien einzugehen. So wirkt der Satz nennt mich nicht nigger bzw. Nennt mich nicht Nigger, ob mit oder ohne Ausrufezeichen, nicht nur insofern problematisch, als er einen aggressiv-pejorativen, wenn nicht dehumanisierenden Ausdruck reproduziert. Es kommt hinzu, dass dieser Satz aus einer ,schwarzen‘ Perspektive formuliert ist, was, wie erwähnt, durchaus als Akt der Appropriation kritisiert werden könnte. Zu eruieren bleibt, ob die Faktur von Redings teils in der ersten, teils in der zweiten und teils in der dritten Person erzählten Geschichten eine solche Kritik schlüssig erscheinen lässt.
Markierung und Devianz
Den Auftakt von nennt mich nicht nigger (nicht aber den der Sammlungen von 1962 und 1978) bildet der Text Jerry lacht in Harlem, bei dem es sich um die überarbeitete Anfangssequenz einer längeren Erzählung handelt, die Reding 1956 in der Heftreihe Spannende Geschichten veröffentlicht hatte. Der Titel dieser Erzählung, der neuerlich die „Zeitgebundenheit“ seines Schreibens zu erkennen gibt und „heute […] wohl kein Lektorat passieren [würde]“ (Wittkowski o. J.), lautet Aufruhr im Negerviertel. [12]
Zu Beginn von Jerry lacht in Harlem schildert ein heterodiegetischer, den Leser bzw. die Leserin direkt adressierender Erzähler einen technisch vermittelten Blick auf den Big Apple:
„Du kannst von der Freiheitsstatue aus mit der Kamera New York ins Bild nehmen. Das New York, das du kennst. Das Lesebuch-New-York: Empire State Building und Radio City Music Hall, Manhattan und den Broadway.“ (Reding 1957: 7) Ersichtlich wird sodann, dass die Eindringlichkeit generierende Apostrophe im Dienst eines gewissen Aufklärungsbedürfnisses steht: „Jetzt schwenke die Kamera nach links“, fordert Redings Erzähler sein Gegenüber auf, „[a]cht Zentimeter nach links nur. Dann bekommst du Harlem in den Sucher. Harlem ist auch New York. Aber Harlem ist das andere New York. Das schwarze New York. Das New York des Drecks. Das New York der Slums. Das New York der Neger.“ (Ebd.)

Einigermaßen irritierend gerät diese Passage dadurch, dass die sie prägende selektive Wahrnehmung zur Assoziation von blackness mit „Dreck[ ]“ und „Slums“ führt. [13] Eine Reflexion der Ursachen für die miserablen Lebensbedingungen in Harlem bleibt jedoch aus, und im Anschluss an ein ,Hineinzoomen‘ in die Szenerie – „Setze ein Teleobjektiv auf deine Kameralinse. Schau hindurch“ (Reding 1957: 7) – wird die benannte Assoziation noch verstärkt: „Du siehst Harlems 135. Straße. Ein paar verrostete Fords stehen herum. Das Füllstroh einer zerborstenen Apfelsinenkiste ist über den Asphalt verstreut. Drüben, einsam, ein Polizist, wie alle Polizisten in Harlem zu Pferde. Zwei Negerfrauen streiten sich, keifen.“ (Ebd.) Neben dem allgegenwärtigen Müll registriert der Erzähler also eine martialische Art der Kriminalitätsprävention sowie einen Fall von defizitärem Sozialverhalten. Dabei ist signifikant, dass die blackness der in misogyner Manier als „keifen[d]“ beschriebenen Frauen qua N-Wort explizit gemacht wird, während eine vergleichbare Kennzeichnung des zuvor erwähnten Polizisten fehlt. Indes dürfte die übergroße Mehrheit von Redings Rezipient:innen noch heute nachgerade automatisch unterstellen, dass es sich bei dem Mann um einen ,Weißen‘ handelt, ist doch zur Genüge gezeigt worden, dass whiteness in Gesellschaften wie der deutschen meist „unmarkiert“ bleibt, aber „dennoch Normen setzt“ (Wachendorfer 2001: 87). Dagegen wird blackness in derlei Gesellschaften gemeinhin als Abweichung vom Standard, als Devianz konzeptualisiert: „Von der weißen Position aus wird Weiß-Sein nicht wahrgenommen, während Schwarz-Sein bedeutungsvoll ist“, sodass eine beständige „Ent-Ethnisierung bzw. ,Ent-Rassifizierung‘ Weißer […] auf Kosten von Schwarzen“ erfolgt, die ihrerseits umso rigoroser „ethnisiert bzw. ,rassifiziert‘“ (ebd.: 89f.) werden. Nachdem Redings Erzähler dann noch auf einen Betrunkenen zu sprechen kommt, der sich auf offener Straße „erbricht“, stellt er so lapidar wie apodiktisch fest: „Das ist Harlem.“ (Reding 1957: 7) Ein solches Zwischenfazit aber mutet angesichts seiner nur oberflächlichen, auf keinerlei ,teilnehmenden Beobachtung‘ basierenden Annäherung an den Stadtteil eher anmaßend denn triftig an.
Redings Protagonist Jerry wiederum begegnet den Leser:innen im Alter von vier Jahren; das Dasein des Jungen wird, wie dasjenige seiner fünf Geschwister, von krasser Armut und von brutalem Rassismus bestimmt. So muss er einmal mitansehen, wie der ,schwarze‘ Weltkriegsveteran Conally von einem ,weißen‘ Mob, der ihn des Diebstahls bezichtigt, schwer misshandelt wird. Da die Jerry-Figur nun als Fokalisierungsinstanz fungiert, werden in dieser Textpartie ,Schwarze‘ und ,Weiße‘ als solche bezeichnet: „Blut rann von dem schwarzen Gesicht über das Soldatenhemd, das Conally behalten durfte, damals, als er mit durchschossener Schulter aus Okinawa wiederkam“, liest man zunächst, und weiter: „Dann schlug der erste Mann aus der Menge der Weißen zu, die immer noch ,go, go, go‘ schrie. Er schlug Conally mit der Faust auf den Kraushaarkopf und auf den Mund, wieder und wieder.“ (Ebd.: 9)
Zugleich beschreibt der Erzähler das Gewaltopfer in reichlich klischeeträchtiger Weise, hebt er doch nicht nur auf dessen „Kraushaarkopf“, sondern auch auf seine „dicken, roten Lippen“ (ebd.: 8) ab, zwischen denen eine Mundharmonika klemmt.
Kurz darauf wird ein Zeitraum von rund zwei Jahren mittels einer Ellipse überbrückt: „Als Jerry sechs Jahre alt war, hatte er noch mehr Hunger.“ (Ebd.: 9) Daher schließt sich der Junge einer kriminellen Kinderbande an, deren Devise lautet: „Du darfst alles tun, wenn es einem Weißen schadet.“ (Ebd.) Suggeriert wird dadurch, dass die Delikte der Minderjährigen durch eine Art ,umgekehrten Rassismus‘ motiviert sind – obwohl de facto meist die Angehörigen des eigenen Milieus unter den Straftaten sozial benachteiligter Individuen leiden (vgl. zum Beispiel Harris und Kearney 2014). Analog dazu werden Jerry und seine Bekannten einmal als „Jungenhorde“ (Reding 1957: 9) inferiorisiert.
Jedenfalls soll sich der Sechsjährige nun am Diebstahl der Kasse aus einem Zeitungskiosk beteiligen – aber der Plan misslingt: „Keiner hatte es gesehen“, heißt es in erlebter Rede, „[d]och. Einer. Der Policeman hier. Der weiße Cop.“ (Ebd.: 12) [14] Allerdings geht dieser Polizist, der selbst Vater von vier Kindern ist, überaus empathisch mit dem auf frischer Tat ertappten Jerry um: „Policeman Peter Brownsing kannte sich aus im Gesicht und in der Seele eines kleinen Jungen, auch wenn dessen Haut schwarz war“ (Reding 1957: 12), bemerkt der Erzähler, und demnach überrascht es nicht, dass Brownsing als prototypischer white savior agiert. Er teilt eine Mahlzeit mit Jerry und verzichtet darauf, dessen Handeln in irgendeiner Weise zu sanktionieren; das Antlitz des Polizisten erscheint dem Sechsjährigen jetzt „nicht mehr so fremd“, sondern „nahe und gut“ (ebd.: 13). [15] Obendrein ergattert Jerry bald darauf einen Job als Zeitungsausträger, sodass er „heute eineinhalb Dollar pro Tag [verdient]“ (Reding 1957: 14). Der Erzähler begrüßt diese Form der Kinderarbeit ohne jede Einschränkung, und so wendet er sich geradezu erleichtert erneut an die Leserin bzw. den Leser: „Ein Happy-End also? – Wenn du willst: ja, Gott sei Dank, ja! […] Doch natürlich hätte die Sache auch anders ausgehen können“ (ebd.: 14) – nämlich dann, wenn Jerry einem anderen Polizisten begegnet wäre. Es folgt der Schlussabsatz: „Aber Jerry hat nun eben Peter Brownsing getroffen. Und ein Sandwich, ein Lächeln und ein Herz. Jerry glaubt nun wieder daran, daß die Welt schön ist. Auch in Harlem. Und Jerry lacht.“ (Ebd.)
Mithin rücken die anfangs benannten sozioökonomischen Härten am Ende von Redings Geschichte in den Hintergrund; zelebriert wird eine individualistisch-voluntaristisch zu realisierende ,Menschlichkeit‘ – was die Grenze zum Kitsch zumindest streift. [16] Darüber hinaus leuchtet es zwar prinzipiell ein, dass ein Kind wie Jerry auf die Hilfe des Erwachsenen Brownsing angewiesen ist, doch wird hier die Tradition der diskursiven Infantilisierung von ,Schwarzen‘ durch ,Weiße‘ unterschwellig bekräftigt. Demnach greift es zu kurz, in dem Polizisten ausschließlich „eine Vorbild-Figur“ zu sehen, „die zeigt, wie eine humanistische Moral, wie tätige Nächstenliebe gelebt werden können.“ (Wittkowski o. J.) [17]
Agency und empowerment
Indes existieren zahlreiche weitere Erzählungen Redings, welche die Diskriminierung von ,Schwarzen‘ (nicht nur) in den Vereinigten Staaten regelrecht anprangern und damit einen – recht diffusen – „Appell an das […] Gewissen“ (Puls 2016: 108) seines vornehmlich ,weißen‘ Publikums richten. Zu prüfen wäre also, in welchem Maße es dem Autor darin jeweils gelungen ist, die Fort- und Festschreibung rassistischen ,Wissens‘ zu vermeiden: [18] Dies kann hier zwar nicht durch akribische close readings, wohl aber durch die Beschäftigung mit einigen exemplarischen Gesichtspunkten geschehen. Von Belang ist außerdem, dass manch einschlägiger Text die Frage aufwirft, inwiefern sich ,Weiße‘ solidarisch zu ,schwarzem‘ Widerstandshandeln verhalten können – eine Frage, die selbstredend auch auf Redings eigene Poetologie zu beziehen ist.
Zu jenen Geschichten aus nennt mich nicht nigger, welche die schweren Lebensbedingungen vieler Afroamerikaner:innen in drastischer, aber auch, wie schon Jerry lacht in Harlem, recht stereotyper Weise schildern, zählt Das Lächeln der alten Gibson. Bei der Protagonistin handelt es sich um „die 72 Jahre alte Negerin“ Penny Delilah Gibson, die in Chicago einen „winzigen Schuhmacherladen“ (Reding 1957: 95) betreibt. Des Weiteren versorgt die Witwe, deren Ehemann einst am Rande einer Demonstration streikender Arbeiter von der Polizei erschossen wurde, jene fünf Enkelkinder, die ihr verantwortungsloser Sohn in ihre Obhut gegeben hat. Gestaltet ist diese Figur, man kann es kaum anders sagen, als eine rassistische Karikatur: „Bobby Hallelujah kleidete sich mit der aufdringlichen, fadenscheinigen Eleganz, in die manche Farbige verfallen, wenn sie sich betont kultiviert geben wollen.“ (Ebd.: 96) Unterhaltszahlungen leistet der Trinker und Spieler ,natürlich‘ nicht, und zu Besuch kommt er nur alle zwei, drei Jahre: „Wenn er dann in der Brettertür erschien, hatte er meist noch ein Weibsbild bei sich, das die Werkstatt sofort mit Zetern und Kreischen erfüllte.“ (Ebd.) Als Bobby Hallelujah seiner Mutter eines Tages ein weiteres Kind aufdrängt und gleich wieder verschwindet, nimmt sich die vollkommen verzweifelte Frau das Leben. Insofern praktiziert Reding in Das Lächeln der alten Gibson eine literarische Elendsmalerei, die auf das Mitleid der Rezipient:innen abzielt und sich dabei einer höchst prekären Figurencharakterisierung bedient. [19] Dagegen nimmt die (Titel-)Erzählung Nennt mich nicht Nigger! eine besonders perfide Manifestation des ,weißen‘ Rassismus in den Blick. Ihr Schauplatz ist ein Kellerlokal in Harlem, das von dem „betriebsamen Italiener“ Luigi Pronco – und damit von jemandem, der selbst einer marginalisierten Minderheit angehört – geführt wird: „[D]ort kamen die Weißen hin, die den Nigger kennenlernen wollten. Den Nigger, wie sie sich ihn vorstellten.“ (Reding 1957: 82)
Das heißt konkret: Pronco veranstaltet Shows mit afroamerikanischen Akrobat:innen und Musiker:innen, deren ,Unterhaltungswert‘ dadurch gesteigert werden soll, dass die Akteur:innen grausame Demütigungen über sich ergehen lassen müssen. Dennoch wird sein Lokal auch von Redings ,schwarzer‘ Hauptfigur (und Fokalisierungsinstanz), dem Maler Bethlehem Long, frequentiert.
Jedoch richtet sich Longs Aufmerksamkeit zuallererst auf das ,weiße‘ Publikum, denn „[s]ein großes Ziel war: einmal das Gesicht der weißen Rasse auf die Leinwand zu bekommen. In einem winzigen lüsternen, lächelnden, verzerrten, geilen, selbstsicheren Gesicht die Visagen aller Weißen zusammenzufassen.“ (Ebd.: 83) Eines Nachts aber verliert der Künstler angesichts eines extrem sadistischen ,Spiels‘ die Fassung: Er echauffiert sich lautstark über die „[w]eiße[n] Teufel“ (ebd.: 86) und wird daraufhin seinerseits als „Nigger“ (ebd.: 87) beleidigt. Nun will Long den Widersacher körperlich attackieren, doch im letzten Moment zuckt er zurück und nimmt eine devote Haltung ein: „Nennt mich nicht Nigger, Sir!“, stammelt er, „[n]ur nicht Nigger, bitte!“ (Ebd.) Dem Gefühl absoluter Erniedrigung sucht das Hate–speech-Opfer anschließend zu entkommen, indem es sich in den Alkohol flüchtet. Jegliches Aufbegehren gegen den ,weißen‘ Terror erscheint dem Maler vergeblich; er verfällt in Resignation. [20]
Das Problem (mangelnder) ,schwarzer‘ agency unter den Bedingungen eines ubiquitären Rassismus – und mithin die Frage nach der Legitimität von (Gegen-)Gewalt – wird auch in der Geschichte Das Urteil des höchsten Richters verhandelt. Im Zentrum der Narration steht ein im ,weißen‘ Kollegenkreis als „Niggerhenker“ bekannter Jurist, über den es unter anderem heißt: „Das war das fünfte Todesurteil, das der junge Richter de Cloche in diesem Monat über Farbige verhängt hatte. Und noch nie wurde ein Weißer hart verurteilt in seiner dreijährigen Amtszeit.“ (Reding 1957: 32) Ursächlich dafür ist ein „schneidende[r] Haß“ auf alle ,Schwarzen‘, „wie ihn nur ein Südstaatler hegen konnte“ (ebd.: 33) – eine Disposition, die de Cloche kaum zu kaschieren sucht. Trotzdem nehmen viele afroamerikanische Prozessbeobachter:innen seine Entscheidungen mit jener „verzweifelte[n] Ergebenheit“ hin, „mit denen die Urgroßeltern dieser Menschen noch die schweren Lederpeitschen ertragen hatten.“ (Ebd.) Bei anderen aber sind sehr wohl Anzeichen für künftige Akte des Widerstands auszumachen: „[E]inige große schwarze Hände ballten sich, und in dunkle Augen sprang ein gefährliches Glimmen.“ (Ebd.) Gegen Ende des Textes ist dann davon die Rede, dass der Richter von einer Gruppe Maskierter entführt und nunmehr selbst angeklagt, für schuldig befunden und auf den elektrischen Stuhl verfrachtet wird – was sich jedoch als Wahnvorstellung des gealterten de Cloche entpuppt. Zudem wird die Vergeltungsmaßnahme keineswegs als Ausdruck eines ,schwarzen‘ empowerment beschrieben, sondern als unbedingt zu verhindernde Katastrophe.
Gewalt(losigkeit) und Kitsch
Eine positive Darstellung erfahren bei Reding hingegen jene Demonstrationen, mit denen das auf Gewaltlosigkeit setzende civil rights movement seine Ziele zu erreichen trachtete. Zum Gegenstand werden sie etwa in der Erzählung Vereinzelt Störungen aus der Sammlung Ein Scharfmacher kommt von 1967, in der sich der ,weiße‘ deutsche Ich-Erzähler in Louisiana an einem solchen Protestmarsch beteiligt (bis die Kundgebung von der Polizei qua Wasserwerfereinsatz aufgelöst wird). [21] Allerdings bedarf die Solidarität des ,Weißen‘ mit den ,schwarzen‘ Bürgerrechtler:innen insofern einer kritischen Einordnung, als dieser von sich behauptet, in seiner Heimat bereits „für gelbe Neger, für Vietnamesen“, auf die Straße gegangen zu sein – „[u]nd für weiße Neger.“ (Reding 1967: 26) Was die befremdlichen Formulierungen transportieren, ist das hehre – und sowohl christlich als auch sozialistisch begründbare – Ideal eines gemeinsamen Kampfes aller Unterdrückten weltweit. Dieses Ideal aber befördert die Ausblendung jener Spezifika der afroamerikanischen Situation, die Redings Protagonist ja erst einmal zur Kenntnis nehmen könnte. Color blindness als eine „großmütige liberale Geste“ zu affirmieren, führt unweigerlich, das hat Toni Morrison (1994: 30) unterstrichen, zu einem in ethischer wie politischer Hinsicht bedenklichen Mangel an Differenzierung. [22]
Eine gewisse Skepsis provoziert das Verhalten eines ,Weißen‘, der sich dem Rassismus in den USA entgegenstellen will, auch in Redings Geschichte Kleine Patsy aus nennt mich nicht nigger. Deren Ich-Erzähler, ein Deutscher namens Bastian, war bereits als Kriegsgefangener in Louisiana gewesen und ist als Austauschstudent dorthin zurückgekehrt. Als seine Heimreise unmittelbar bevorsteht, lernt er die ,schwarze‘ Kellnerin Patsy kennen, und am Hafen kommt es zu einer Abschiedsszene zwischen den beiden.
Da beginnt ein ,weißer‘ Arbeiter, aggressiv herumzubrüllen: „Haha, schau dir die Niggerprinzessin an, die den langen Blonden da abknutscht. Das schwarze Biestchen hat Mut!“ (Reding 1957: 31) Weitere rassistische Invektiven folgen, und darauf reagiert der Deutsche – scheinbar – so: „Ich […] schlug ihm die Faust in das breite Gesicht. Und noch einmal und wieder. […] Und ich sagte: ,Du Schwein!‘“ (Ebd.) De facto aber handelt es sich bei dieser Gewalttat, wie auch bei derjenigen in Das Urteil des höchsten Richters, um eine bloße Phantasie: diesmal freilich um eine lustbesetzte. Da Bastian in der Realität nicht zum white savior (oder eher: white avenger) taugt, endet der Text mit einem läppischen „Excuse me“ (ebd.) des Arbeiters – und mit Patsys wortlosem Verschwinden. Angesichts dessen mag man durchaus den Eindruck gewinnen, dass ein physisches Einschreiten des Erzählers zumindest entschuldbar gewesen wäre. [23]
Während Reding in Kleine Patsy die Handlungsunfähigkeit eines wohlmeinenden Humanisten zur Darstellung bringt, [24] überantwortet er andernorts bestimmte Formen der ästhetischen Auseinandersetzung mit dem Rassismus der Kritik seines Publikums. In der Erzählung Zeit für Blues im Band Ein Scharfmacher kommt betrifft das einerseits die musikalischen Darbietungen ,weißer‘ deutscher Interpret:innen im kirchlichen Milieu, die der Protagonist, ein Schriftsteller, als nachgerade zynische Verkitschungen ,schwarzen‘ Leidens wahrnimmt. [25] Andererseits erhebt er harsche (und heutzutage weithin geteilte) Einwände gegen Harriet Beecher Stowes abolitionistischen Weltbestseller Uncle Tomʼs Cabin von 1852: „Onkel Tom hat zwar die Seele voller Kummer, aber schlägt nicht zurück, wenn Massa White ihn peitscht. Nein, dann ruft Onkel Tom o lord! und freut sich gar mächtig auf die liebliche Prunkkutsche zum Himmel.“ (Ebd.: 101) Das Prinzip der Gewaltlosigkeit wird bei Reding also nicht immer verklärt!
Aktivismus und Lippenbekenntnis
Besonders differenziert werden die race relations in den Vereinigten Staaten in Verbindung in Mississippi behandelt, einer zunächst in allein in babylon von 1960 und erneut in Nennt mich nicht Nigger von 1978 veröffentlichten Erzählung. Diese schildert eingangs eine Zufallsbegegnung zwischen dem ,weißen‘ deutschen Arzt Herbert Pietsch und dem afroamerikanischen Maurer Humphrey Wallet und zielt in der Folge unübersehbar darauf ab, rassistische Stereotype zu widerlegen, darunter dasjenige der generellen ,Bildungsferne‘ der ,schwarzen‘ Minderheit in den USA: Während es für Wallet selbst noch „schwerlich möglich“ war, eine Universität zu besuchen, hat sein Sohn Frank es zum Chemiker gebracht; die Tochter Dorothy hingegen „steht vor ihrem Examen als Lehrerin.“ (Ebd.: 158) Obendrein erweist sie sich als passionierte Goethe-Leserin – eine keineswegs abwegige Eigenschaft der Figur, fungierte Goethe im Diskurs afroamerikanischer Akademiker:innen des 20. Jahrhunderts doch gelegentlich als Referenzautor. Ursächlich dafür waren in erster Linie entsprechende intertextuelle Bezüge, hauptsächlich auf den ersten Teil des Faust (1808), in W. E. B. Du Boisʼ bahnbrechendem Werk The Souls of Black Folk von 1903, dessen Autor ja von 1892 bis 1894 in Berlin studiert hatte (vgl. etwa Hamilton 1996).
Ein weiteres Kernelement des geläufigen ,Wissens‘ über Afroamerikaner:innen dekonstruiert Redings Verbindung in Mississippi insofern, als Familie Wallet mitnichten in desolaten, sondern in ziemlich komfortablen Verhältnissen lebt, genauer: in einem „Bungalow[ ], der zu jeder Zeit das Titelbild einer Zeitschrift der High Society hätte schmücken können“ (Reding 1978: 160). Der Figur des Vaters ist vollends bewusst, dass ihr ,weißer‘ Hausgast dies für verwunderlich erachtet; offenkundig habe der Deutsche angenommen, dass „ein Mann wie ich […] in einem Elendsquartier mit rostzerfressenen Feuerleitern vor der Fassade und feuchter Wellpappe im Fensterrahmen [wohnt]“ (ebd.: 160f.). Einst sei dies auch tatsächlich der Fall gewesen; die Solidarität innerhalb der ,schwarzen‘ Community habe jedoch eine grundlegende Veränderung seiner Situation ermöglicht: „[D]as Häuschen ist in Gemeinschaftsarbeit entstanden. Außerhalb der Saison haben wir Maurer […] Jahr um Jahr solch eine Klitsche gebaut. Das sind die Hütten von Onkel Toms Söhnen.“ (Ebd.)
Bemerkenswert ist Redings Geschichte aber vor allem deshalb, weil sie auf eine wohlfeile Harmonisierung politischer Gegensätze, die mit dem Faktor race zusammenhängen, konsequent verzichtet.
So geriert sich Pietsch zwar als überzeugter Gegner jeglicher ,Rassentrennung‘ – „Ich bin für Zusammenleben zwischen Weißen und Farbigen“ (ebd.: 163), bekundet er –, doch will er gleichwohl zum Vollmitglied einer fraternity ,aufsteigen‘, die ,Nicht-Weißen‘ die Aufnahme verweigert. Diese Bigotterie lässt ihm Dorothy indes nicht durchgehen; der halbherzige Entschuldigungsversuch des Arztes – „Wenn man in einem Land als Gast ist, macht man am besten alles mit, was an einen herangetragen wird“ (ebd.) – verfängt bei der jungen Frau keineswegs. [26]
Daran ändert es nichts, dass Pietsch sodann „eifrig“ beteuert, „alle Unterdrückung“ zu verabscheuen, und er sich entsetzt darüber zeigt, dass in Mississippi unlängst „der 534. Lynchmord verübt wurde“ (ebd.: 164). Anstatt ihm die ersehnte Anerkennung zu zollen, bescheidet Dorothy dem Besucher sarkastisch, dass das ja „eine verhältnismäßig kleine“ Zahl sei, und als dieser mit „Entrüstung“ auf ihren Einwurf reagiert, provoziert sie ihn noch weiter: „Streitet man sich in Ihrem Vaterland nicht darüber, ob ein Teil Ihrer Landsleute sieben oder nur vier Millionen ermordet hat?“ (Ebd.) Bei dem Deutschen ruft diese rhetorische Frage eine Erschütterung hervor, die viele zeitgenössische Leser:innen von Redings Erzählung vermutlich gut nachvollziehen konnten: „Pietsch schwieg lange. Dann schaute er dem Mädchen in die Augen. ,Warum sagen Sie das?‘ fragte er. ,Ich war gerade 16 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging.‘“ (Ebd.: 164) Seine Diskussionspartnerin aber lässt nicht locker, sodass ein versöhnliches Ende der Geschichte ausbleibt: „,Und heute sind Sie doppelt so alt“, stellt sie ungerührt fest, „und tun aus Ulk den ersten Schritt in eine Marschrichtung, die wieder auf Ihr damals propagiertes Herrenmenschentum hinausläuft.‘“ (Ebd.)
Mithin werden die für den Text relevanten historischen Phänomene in Verbindung in Mississippi auf produktiv-irritierende Art und Weise literarisiert. Denn obgleich die vom ,weißen‘ Protagonisten geäußerte Empörung über den in der US-amerikanischen Gesellschaft verwurzelten Rassismus in der Sache mehr als gerechtfertigt ist, entlarvt die ,schwarze‘ Dorothy-Figur sie als bloßes Lippenbekenntnis – und als zumindest partiell durch ein auf die Shoah bezogenes Schuldabwehrbedürfnis bedingt.
Benennung und Reflexion
Einer gesonderten Betrachtung – die hier nur sehr knapp ausfallen kann – bedürfen jene Texte Redings, in denen nicht die race relations innerhalb der Vereinigten Staaten, sondern Begegnungen zwischen ,weißen‘ Europäer:innen und ,schwarzen‘ Afrikaner:innen zum Thema werden. Neben der bereits am Rande erwähnten Geschichte Diesseits der Zensur, deren Plot sich in Südafrika entfaltet, betrifft das zum Beispiel Die Nacht nach dem Panther, eine erstmals 1963 in der Sammlung PAPIERSCHIFFE GEGEN DEN STROM publizierte, 1978 in Nennt mich nicht Nigger wiederabgedruckte Erzählung: Darin räsonieren einige nach Kamerun entsandte europäische ,Entwicklungshelfer‘ über die Sinnhaftigkeit ihres Tuns, doch wird passagenweise auch der Einheimische Nʼdi zur Fokalisierungsinstanz. [27] In der Geschichte Nipfes visitiert aus dem Band Ein Scharfmacher kommt wiederum besucht ein deutscher Prälat ein nicht konkret benanntes zentralafrikanisches Land, wobei sich sein Interesse weit eher auf die Fortschritte der kirchlichen Missionstätigkeit als auf diejenigen der Hungerbekämpfung richtet.
Jegliche Kritik an dieser Prioritätensetzung kanzelt der selbstgerecht auftretende ,Weiße‘ kurzerhand als ,marxistisch‘ ab (vgl. Reding 1967: 50), sodass er ohne Zweifel als Negativfigur einzustufen ist. Zur Identifikation lädt dagegen sein Antagonist Muel ein, besitzt der an europäischen Universitäten ausgebildete ,schwarze‘ Intellektuelle doch ein ungleich höheres Reflexionsvermögen als Nipfes, wie dies (nicht nur) der folgende verbale Schlagabtausch belegt. „Hätte ich hier in Zentralafrika nicht erwartet“, bekundet der Geistliche gönnerhaft, „[e]inen Ne- – einen Eingeborenen, der so gut Deutsch spricht, der überhaupt Deutsch spricht.“ (Ebd.: 46f.) Darauf repliziert Muel in mehr als souveräner Manier: „Sie können ruhig Neger sagen, Monsignore […]. Das ist genauso töricht wie Eingeborener. Ich weiß, das Vokabular der Europäer zur Bezeichnung eines Afrikaners ist schmal. Was soll ich zu Ihnen sagen, Monsignore? Guten Tag, Weißer oder Einheimischer oder Boy?“ (Ebd.: 47) Über das in der deutschen Nachkriegsliteratur Übliche geht Reding mit dieser gleichermaßen kirchen- wie rassismuskritischen Dialoggestaltung weit hinaus. Insgesamt aber sind afrikanische Sujets für sein œuvre eben doch von geringerer Bedeutung als afroamerikanische.
Antirassismus und Klischee
Sowohl in Redings nennt mich nicht nigger von 1957 als auch im Gros der übrigen ausgewerteten Anthologien wechseln sich Erzählungen, die um die intrikaten Sozialbeziehungen zwischen ,Schwarzen‘ und ,Weißen‘ in den USA kreisen, in unregelmäßiger Weise mit Geschichten ab, die allein die Erlebnisse ,weißer‘ Figuren vergegenwärtigen – ob die Handlung nun in (West-)Deutschland oder Frankreich, in Portugal oder der Sowjetunion angesiedelt ist. Schon durch diese Anordnung seiner Texte hat der Autor eine Exotisierung ,schwarzer‘ Lebenswelten zu vermeiden gesucht (vgl. Reding 1978: 7), und dazu fügt es sich, dass erwachsene afroamerikanische Figuren bei ihm meist einen vollständigen Namen tragen und dadurch implizit als vollständige Subjekte ausgewiesen sind. Demgemäß werden sie oftmals mit erklecklicher erzählerischer Empathie bedacht – was in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur keineswegs selbstverständlich war. [28]
Nicht unproblematisch erscheint die sich darin niederschlagende christlich-universalistische Haltung Redings freilich insofern, als sie, in den Worten Bernhard Waldenfelsʼ (1990: 60), einer „Bändigung der Fremdheit“ mittels ihrer „Aneignung“ Vorschub leistet. Zu berücksichtigen ist jedoch das grundsätzliche Dilemma, das Jochen Dubiel (2007: 147f.) wie folgt umrissen hat: Zum einen kann man „die Unmöglichkeit, über das Fremde zu sprechen, nicht […] leugnen“, denn ein solches Sprechen „bedeutet immer eine Form der Aneignung“; zum anderen aber „besteht die dringende Notwendigkeit, über das Andere zu reden, denn wer aus Angst, dem Fremden Gewalt anzutun, schweigt, der übt Gewalt aus durch Mißachtung.“ Aufzulösen ist dieser double bind vermutlich nicht.
Unabhängig davon kann man in der Tat festhalten, dass Redings Erzählungen durch ein „tiefes Mitfühlen“ geprägt sind und entschieden „für Minderheiten, Missachtete und Beleidigte“ (Puls 2016: 107) Partei ergreifen. Allerdings irritiert es, wie bereits angesprochen, dass der Autor sein antirassistisches Engagement offenbar als Beitrag zur ,Wiedergutmachung‘ der Verbrechen des Nationalsozialismus begriff.
Verstärkt wird diese Irritation dadurch, dass sich bei ihm mitunter Formulierungen finden, welche die Unterschiede zwischen der ,Rassendiskriminierung‘ in den Vereinigten Staaten und der genozidalen Politik des Hitler-Regimes eher verwischen als verdeutlichen.
Allerdings sollte man nicht ausblenden, dass Reding dieses Problem von Zeit zu Zeit durchaus reflektiert hat, etwa in der Geschichte Während des Films …, die zunächst in allein in babylon und später auch in Nennt mich nicht Nigger erschien. Darin relativiert und bagatellisiert die Figur eines unbelehrbaren Deutschen die Shoah mittels einer Reihe rhetorischer Fragen: „Die anderen sollen sich an ihre eigenen Nasen packen. Was machen die Franzosen mit den Algeriern? Die Amerikaner mit den Negern? Und damals? Was haben die Russen mit unseren Frauen gemacht? Und die englischen Luftgangster mit unseren Ruhrgebietsstädten?“ (Reding 1978: 189)
Lohnend dürfte es sein, zu Vergleichszwecken künftig auch solche Texte Redings in den Blick zu nehmen, die nicht das Verhältnis zwischen ,Schwarzen‘ und ,Weißen‘, sondern die Situation von Native Americans oder Asian Americans in den USA behandeln: Ersteres geschieht zum Beispiel in Im Golfstrom der Dünste aus dem Band allein in babylon, letzteres in Skalpell durchschneidet roten Rausch, einer recht bizarren Erzählung aus nennt mich nicht nigger, in der ein ,weißer‘ Amerikaner in der Chinatown von San Francisco eine ,Opiumhöhle‘ aufsucht und in der Folge von der Wahnvorstellung befallen wird, man habe seine Augen zu „Schlitzaugen“ (Reding 1957: 79) umoperiert. Auch hier dürfte ersichtlich werden, dass Redings Schreiben zwar auf die Unterminierung ethnizistischer Klischees abzielt, es derlei Klischees jedoch bisweilen unwillkürlich bestätigt. Gewiss wird das vehemente Eintreten des Autors für die Überzeugung von der Gleichheit aller Menschen dadurch nicht entwertet. [29] Ungebrochen affirmieren lässt sich die von ihm kreierte Spielart eines literarischen Antirassismus angesichts der ihr eignenden Ambivalenzen aber wohl kaum.
Endnoten
[1] Von vielen afrodeutschen Autor:innen der Gegenwart wird das Adjektiv ,schwarz‘ „mit einem großen ,S‘“ geschrieben und dadurch zur „politische[n] Selbstbezeichnung“ (Otoo 2019: 57) erhoben. Gerade weil diese Schreibweise auf ein emanzipatorisches self-labeling verweist, hielte ich es als ,weißer‘ Autor jedoch für unangebracht, sie ebenfalls zu verwenden. Deshalb beschränke ich mich darauf, den Konstruktionscharakter der Termini ,schwarz‘ und ,weiß‘ mittels einfacher Anführungszeichen zu markieren.
[2] 1959 kehrte Reding für einige Monate in die USA zurück, um als Gastdozent an der katholischen, ausschließlich von ,Schwarzen‘ besuchten Xavier University of Louisiana in New Orleans zu lehren. Mitunter hat man diese Gesichtspunkte retrospektiv stark überhöht, etwa in einem Klappentext, laut dem Reding einst „zur Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings [gehörte]“ und „in den Slums von Harlem und New Orleans [lebte]“ (Reding 1984).
[3] Zustimmung verdient auch die Feststellung, dass diese Ausrichtung von Redings Schreiben des Weiteren durch dessen „christlichen Humanismus“ und seine „Erfahrung des Faschismus“ (Wittkowski o. J.) bedingt war.
[4] Diese Aspekte spielten auch in der jüngst aufgeflammten Debatte um die Frage, ob sich Wolfgang Koeppens kanonischer Roman Tauben im Gras (1951) als Lektüre für den schulischen Deutschunterricht eigne, eine wichtige Rolle. So leugneten diejenigen, die diese Frage verneinten, Koeppens antirassistische Intention keineswegs, und sie monierten auch nicht bloß die Omnipräsenz des N-Worts in seinem Text. Vielmehr war bereits in der Petition der Ulmer Lehrerin Jasmin Blunt, die den Ausgangspunkt der Debatte bildete, die stereotype Charakterisierung der afroamerikanischen Figuren als ein Faktor angeführt worden, der gegen die Behandlung von Tauben im Gras im Unterricht spreche. Vgl. zu den Details den erhellenden Artikel von Sigrid Köhler (2023), deren Werturteilen man sich freilich nicht zwingend anschließen muss. In jedem Fall kann der öffentlichen Kontroverse um Koeppens Roman ein höheres Argumentationsniveau als vergleichbaren früheren Diskussionen attestiert werden, die sich allzu sehr auf den Umgang mit dem Gebrauch des N-Worts und ähnlicher Termini in (älteren) Werken der Kinder- und Jugendliteratur kapriziert hatten. Vgl. dazu meine Überlegungen in Hermes (2015: 10–12) sowie die dort genannte weiterführende Literatur.
[5] Vgl. dazu die (nicht direkt literaturbezogenen) Überlegungen von Cornel West (1994: 21f.) in seinem einflussreichen Band Race Matters.
[6] 17 Geschichten waren erstmals 1960 in allein in babylon, 8 weitere 1963 in PAPIERSCHIFFE GEGEN DEN STROM erschienen. Demnach entstammen die Texte in Nennt mich nicht Nigger zwar in der Tat zwei Jahrzehnten, zugleich aber decken sie lediglich einen Publikationszeitraum von rund 6 Jahren ab.
[7] In der Titelei dieser Ausgabe ist irrtümlich vermerkt, der Band sei „erstmals im Jahr 1957“ (Reding 2020: 4) herausgekommen.
[8] Wenig überzeugend gerät im Übrigen Redings Versuch, die Kurzgeschichte zu einer besonders ,ruhrgebietstauglichen‘ Gattung zu erklären: „Heute bin ich sicher, dass mein spontaner Aufgriff der Kurzgeschichte auch mit der Ausdrucksweise der Menschen zu tun hat, unter denen ich aufgewachsen bin: den Menschen des Ruhrgebiets. In dieser Landschaft herrscht im sprachlichen Ausdruck das Knappe vor, eine anziehende Sprödigkeit des Ausdrucks. Der Gesprächspartner, der Kumpel, bekommt nur weniges mitgeteilt und muß sich auf manche karge Anspielung seinen ,eigenen Reim‘ machen, muß also mitdenken, mitdichten.“ (Reding 1978: 6)
[9] Noch deutlicher hatte er dies bereits in einem am 18. Mai 1959 in Baton Rouge, Louisiana, verfassten Brief an seinen ehemaligen Lehrer am Gymnasium in Castrop-Rauxel, Walther Küper, getan. Darin heißt es: „Vielleicht trage ich, indem ich im Mitarbeiterkreis von Martin Luther King mitmache, ein wenig von dem Rassenwahnsinn ab, der in Deutschland grassierte. Ich bin sicher, daß unsere Welt nie so wird, wie wir sie haben wollen, wenn wir uns gegenseitig nach den Hautfarben werten – was ja zumeist bedeutet, uns aufwerten, und den anderen abwerten. Herrenmensch. Untermensch.“ (Reding 1979: 30)
[10] Ähnlich positioniert sich Reding (1981: 8) im Nicht für die Mächtigen betitelten Vorwort zu Die Stunde dazwischen. Zehn Geschichten: „Wer aber kümmert sich um den Zukurzgekommenen? Wer spricht für den, der für die Öffentlichkeit am Rande, als Hinterherhinkender fungiert? Wer beschreibt die innere Verfassung der Gescheiterten, der Untüchtigen, der Kranken, der Versager?“, fragt er dort. Analog dazu begreift er es als das Ziel seiner Arbeit, „[d]ie Welt [zu] verändern“, wenngleich eher im Kleinen: „Ich würde mein Schreiben schon nicht als vergeblich auffassen, wenn einige Leser empfindsamer geworden sind, nachdenklicher. Wenn also nach der Lektüre einer meiner Geschichten ein Denken, ein Überlegen einsetzt. Vielleicht entsteht aus dem Überlegen ein Handeln?“ (Ebd.: 10)
[11] Augenöffnend war diesbezüglich Gayatri Chakravorty Spivaks berühmter, erstmals 1988 veröffentlichter Essay Can the Subaltern Speak?: In diesem Grundlagentext postkolonialer Theoriebildung demonstriert Spivak, weshalb bestimmte Bevölkerungsgruppen über keinerlei Möglichkeit der Selbstrepräsentation verfügen – und weshalb es ihre Lage mitnichten verbessert, wenn Außenstehende (und sei es in bester Absicht) den Anspruch erheben, für die Subalternen zu sprechen.
[12] In diesem Kontext tritt besonders klar zutage, dass Redings zwischen U- und E-Segment oszillierende Publikationspraxis als regelrechte Wiederverwertungsmaschinerie beschreibbar ist. So findet sich Aufruhr im Negerviertel auch in dem Band Höllenpfuhl Sargasso. Abenteuer um Recht und Gesetz (1957); dort aber fehlt just die in nennt mich nicht nigger enthaltene Eingangspassage (vgl. Wittkowski o. J.). Des Weiteren schuf Reding das Theaterstück Die Harlem-Story (1960), das auf Aufruhr im Negerviertel basiert; einstudiert werden sollte es von jugendlichen Laien.
[13] Der Terminus blackness ist, das sei ausdrücklich betont, nicht in einem essentialistisch-biologistischen Sinne zu verstehen, sondern denotiert „a political and ethical construct“ (West 1994: 39).
[14] Interessanterweise fehlen die englischen Ausdrücke an der entsprechenden Stelle in Aufruhr im Negerviertel; dort tritt noch ein „Schupo“ (Reding 1956: 4) auf. Und auch einige andere Formulierungen hat Reding nachträglich ,amerikanisiert‘: So wird in Jerry lacht in Harlem ein „Sandwich“ (Reding 1957: 13f.) verzehrt – und nicht mehr, wie in Aufruhr im Negerviertel, ein „Butterbrot“ (Reding 1956: 5).
[15] Im Drama Die Harlem-Story apostrophiert der Junge seinen Wohltäter sogar als „rettende[n] Engel“ (Reding 1960b: 36)!
[16] Eine andere Ansicht vertritt – allerdings mit Blick auf Aufruhr im Negerviertel – Wittkowski (o. J.): Zwar könne der „Verdacht“ entstehen, „hier verdecke ein Happy End alle sozialen Gegensätze“, doch setze Reding einem solchen „Eindruck“ die „Erklärung des Erzählers“ entgegen, „dass alles hätte anders kommen können“. Diesem nicht sonderlich starken Argument fügt Wittkowski (ebd.) ein zweites hinzu, das bezogen auf Jerry lacht in Harlem aber keine Gültigkeit besitzt: Reding habe ja eine Fortsetzung des Geschehens entworfen, in der die ehemaligen Komplizen des Protagonisten Rache an ihm nehmen wollen. Bedeutsam ist allerdings der Hinweis darauf, dass der oben zitierte Schlussabsatz in jener Version der Geschichte, die im Band Nennt mich nicht Neger von 1978 publiziert wurde, ersatzlos gestrichen ist (vgl. ebd.). Dadurch werden die skizzierten Probleme zwar nicht vollständig gelöst, aber doch abgemildert.
[17] Hinzuzufügen ist allerdings, dass Reding andernorts einen ,schwarzen‘ Ordnungshüter als „Vorbild-Figur“ angelegt hat und dadurch „eine antirassistische Lehre [vermittelt]“ (Wittkowski o. J.): Gemeint ist der FBI-Agent Zebediah in der Erzählung Wetbacks am Rio Grande, die zuerst 1954 in der Spannende-Geschichten-Reihe und dann in Höllenpfuhl Sagossa erschien.
[18] Wenn rassistische Überzeugungen in diesem Aufsatz als ,Wissen‘ ernst genommen werden, dann in dem Sinne, dass „die Mitglieder eines räumlich und zeitlich begrenzten soziokulturellen Systems“ sie mehrheitlich „für wahr h[ie]lten“: Es ist also nicht entscheidend, ob derlei „im Rahmen unseres Wissens als wahr gilt“ (Richter, Schönert und Titzmann 1997: 12).
[19] Nicht erfüllt wird somit eine berechtigte Forderung, die unter anderem Cornel West (1994 :6), wenngleich ohne Bezug zum literarischen Diskurs, erhoben hat: „To engage in a serious discussion of race in America, we must begin not with the problems of black people but with the flaws of American society – flaws rooted in historic inequalities and longstanding cultural stereotypes.“
[20] Schier unmöglich mutet ein aktives Vorgehen gegen das alltägliche Unrecht auch in der Geschichte Wächter der Verfassung an, die erstmals 1958 in wer betet für judas? und abermals 1978 in Nennt mich nicht Nigger erschien. Darin wird an der Figur des Kriegsversehrten Zachary Crust demonstriert, wie sehr speziell die ökonomische Ungleichbehandlung der afroamerikanischen Bevölkerung den Grundsätzen der US-Verfassung hohnspricht. In Redings Erzählung Vor der Wahl in Chattanooga wiederum, die ebenfalls in wer betet für judas? und später in Nennt mich nicht Nigger veröffentlicht wurde, muss sich der gebildete ,Schwarze‘ Randolph Hesekiel in Tennessee von Mitgliedern des Ku-Klux-Klan schikanieren lassen. „Wenn ein Schwarzer weniger verdient, ist er eben fauler“, bescheiden sie ihm; „[d]azu pennt er, wenn die anderen arbeiten und macht ein Dutzend Kinder oder was weiß ich. Jedenfalls: In unserem Land kann jeder so viel verdienen, wie er will, wenn er sich rührt. Klar?“ (Reding 1978: 61) Der Mythos vom American Dream, wie er ja auch im Westdeutschland der Nachkriegszeit unentwegt beschworen wurde, erfährt hier also eine denkbar zynische Instrumentalisierung.
[21] Außerdem enthält der Text eine besonders verstörende Episode über den Rassismus im Süden der Vereinigten Staaten: Diese kreist um eine junge ,weiße‘ Frau, die nach einem Autounfall die Blutspende einer ,Schwarzen‘ mit dem Ausruf „Kein Niggerblut, solange ich lebe!“ (Reding 1967: 22) ablehnt – und deshalb eine Viertelstunde später tot ist. In der Folge dekonstruiert die Figur der ,Schwarzen‘ die absurde Fixierung des rassistischen Denkens auf den Topos des Bluts.
[22] Eine antirassistische Demonstration bildet auch das Sujet von Redings Diesseits der Zensur, einer 1960 in allein in babylon und dann 1978 in Nennt mich nicht Nigger publizierten Geschichte in Briefform, deren Schauplatz offenbar das Südafrika der Apartheid-Ära ist. Obwohl der Protagonist, ein ,weißer‘ Fotoreporter, selbst mancherlei Ressentiments gegen ,Schwarze‘ hegt, begreift er, dass das herrschende Regime überwunden werden muss.
[23] Entschuldbar wirkt denn auch jene Handgreiflichkeit, zu der sich der Protagonist von Diesseits der Zensur tatsächlich hinreißen lässt, als er das brutale Vorgehen eines Polizisten gegen eine schwangere Demonstrantin bezeugen muss.
[24] Eine vergleichbare Hilflosigkeit kennzeichnet das Verhalten des Ich-Erzählers der Geschichte Aus ziseliertem Silber, die 1977 in Redings Anthologie Schonzeit für Pappkameraden erschien. Darin lädt ein ,weißer‘ deutscher Austauschstudent einen afroamerikanischen Kommilitonen in New Orleans in ein Restaurant ein, wo dieser jedoch nicht bedient, sondern rassistisch beleidigt und physisch angegriffen wird.
[25] Daher setzt er ihnen schonungslose Berichte über rassistische Gewaltexzesse in den Südstaaten der USA entgegen: „Lynchgalgen? Schlimmeres. Männer mit hellen Pigmenten in der Haut entmannen einen Mitbürger mit dunklen Pigmenten in der Haut und zwingen ihn zu einem entsetzlichen Selbstkannibalismus, weil der Dunkle einer Hellen nachgepfiffen hat.“ (Reding 1967: 100f.) Außerdem ist neuerlich die für Reding typische Verknüpfung des US-amerikanischen Rassismus mit den Verbrechen des ,Dritten Reichs‘ zu beobachten, wenn der Autor seine Hauptfigur befürchten lässt, in Deutschland werde man bald „die Schlieren unserer eigenen Geschichte mit einem Buchenwald-Blues [melodisieren]“ (ebd.: 101).
[26] Einen anderen Fall von inakzeptabler Loyalität unter ,Weißen‘ präsentiert Reding in der Erzählung Der Dollarjäger von Punta Palocci in nennt mich nicht nigger. Dort greift der Ich-Erzähler einem Dockarbeiter, der als einziger ,Weißer‘ unter ,Schwarzen‘ schuftet, aus Mitleid finanziell unter die Arme. Der Arbeiter aber entpuppt sich als gewiefter Betrüger, wodurch den Leser:innen in beinahe didaktischer Manier vor Augen geführt wird, wie abstrus das Konzept der ,Rassensolidarität‘ ist.
[27] Die autobiographische Dimension von Die Nacht nach dem Panther ist unter anderem daran zu erkennen, dass PAPIERSCHIFFE GEGEN DEN STROM auch mit (überarbeiteten) Tagebuchaufzeichnungen Redings aufwartet, die dessen 1962 unternommene Reise nach Kamerun, Benin und in die Elfenbeinküste dokumentieren. Die deutschen Kolonialverbrechen in Kamerun kommen in diesen Notaten, in denen eine Tendenz zur Glorifizierung vermeintlich ,ursprünglicher‘ Lebensweisen zu registrieren ist, ebenfalls zur Sprache (vgl. Reding 1963: 195).
[28] Generell stellt der überaus empathische Umgang mit seinen Figuren ein Charakteristikum von Redings Schreiben dar. Für angemessen kann man derlei mit Blick auf einen Text wie Mühsam stirbt der Schnee halten, der 1958 in wer betet für judas? und zwei Dekaden später in Nennt mich nicht Nigger publiziert wurde: Darin sieht sich eine Überlebende der Shoah mit dem Fortwirken des Antisemitismus in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft konfrontiert. Ganz anders verhält es sich jedoch mit der Geschichte Schuhputzstand in Manhattan aus nennt mich nicht nigger, in der die narrative Empathie ausgerechnet einem ehemaligen SS-Angehörigen gilt. Bei Kriegsende war dieser von einem US-Soldaten gefoltert worden, und nach etlichen Jahren kommt es in New York zu einer zufälligen Wiederbegegnung zwischen den beiden. Der Deutsche, der mittlerweile zu einem erfolgreichen Geschäftsmann avanciert ist, verspürt ein intensives Rachebegehren, rührt den Amerikaner, der sich als Schuhputzer verdingen muss, aber letztlich nicht an.
[29] Besonders drastisch wird dieser Egalitätsgedanke in der Geschichte Von gleicher Farbe aus allein in babylon vermittelt, die auch in Nennt mich nicht Nigger enthalten ist: Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kommen ein ,schwarzer‘ und ein ,weißer‘, zutiefst rassistisch eingestellter US-Infanterist durch den Flammenwerfer eines deutschen Panzers zu Tode. Ihre Leichen sind so schwer verstümmelt, dass es vollkommen unmöglich ist, die beiden noch voneinander zu unterscheiden.
Bibliographie
Beck, Hamilton (1996): „W. E. B. Du Bois as a Study Abroad Student in Germany, 1892–1894“, in: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ608183.pdf [25.08.2023].
Dubiel, Jochen (2007): Dialektik der postkolonialen Hybridität. Die intrakulturelle Überwindung des kolonialen Blicks in der Literatur, Bielefeld.
Göttsche, Dirk (2010): „Vereinnahmung oder postkoloniale Bewusstseinsbildung? Beobachtungen zur Darstellung afrikanischer Perspektiven auf die Kolonialgeschichte in neuen historischen Afrika-Romanen“, in: Literatur für Leser 33.4, S. 211–231.
Göttsche, Dirk (2013): Remembering Africa. The Rediscovery of Colonialism in Contemporary German Literature, Rochester.
Harris, Benjamin H. und Melissa S. Kearney (2014): „The Unequal Burden of Crime and Incarceration on America’s Poor“, in: www.brookings.edu/articles/the-unequal-burden-of-crime-and-incarceration-on-americas-poor/ [25.08.2023].
Hermes, Stefan (2015): „,Warum soll man nicht schwarz sein?‘ ,Blackness‘ und ,Whiteness‘ in Michael Endes Jim-Knopf-Romanen“, in: Acta Germanica. Jahrbuch des Germanistenverbandes im südlichen Afrika 43, S. 9–27.
Hermes, Stefan (2016): „Grenzen der Repräsentation. Zur Inszenierung afrikanisch-europäischer Begegnungen in Jenny Erpenbecks Roman ,Gehen, ging, gegangen‘“, in: Acta Germanica. Jahrbuch des Germanistenverbandes im südlichen Afrika 44, S. 179–191.
Hermes, Stefan (2022): „Jenseits des Schwarz-Weiß-Denkens. Intersektionale Perspektiven in aktuellen Romanen afrodeutscher Autorinnen (Jackie Thomae, Olivia Wenzel)“, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 141.2, S. 281–306.
Morrison, Toni (1994): Im Dunkeln spielen. Weiße Kultur und literarische Imagination, Reinbek bei Hamburg.
Otoo, Sharon Dodua (2019): „Liebe“, in: Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah (Hg.): Eure Heimat ist unser Alptraum, 5. Aufl., Berlin, S. 56–68.
O.V. (1979): „Biographische Daten“, in: Hedwig Gunnemann (Hg.): Josef Reding. Fünf Jahrzehnte Leben –Drei Jahrzehnte Schreiben. Zeugnisse seines Lebens, Dortmund, S. 14–18.
[Palberg, Kyra] (o. J.): „Josef Reding. ,Heimat ist die Umwelt, in der ich mich nach Begabung und Willen als Mensch verwirklichen kann.‘ Reding und das Ruhrgebiet“, in: www.josef-reding.de/josef-reding/ [25.08.2023].
Puls, Gerd (2016): „Bekenntnis zu den Missachteten. Josef Reding: ,Nennt mich nicht Nigger. Geschichten‘ (1957)“, in: Moritz Baßler u. a. (Hg.): Vom Heimatroman zum Agitprop. Die Literatur Westfalens 1945–1975. 118 Essays, Bielefeld, S. 105–109.
Richter, Karl, Jörg Schönert und Michael Titzmann (1997): „Literatur – Wissen – Wissenschaft. Überlegungen zu einer komplexen Relation“, in: Dies. (Hg.): Die Literatur und die Wissenschaften 1770–1930, Stuttgart, S. 9–36.
Reding, Josef (1956): Aufruhr im Negerviertel, Gütersloh.
Reding, Josef (1957): nennt mich nicht nigger. geschichten, Recklinghausen.
Reding, Josef (1958): wer betet für judas? geschichten, Recklinghausen.
Reding, Josef (1960a): allein in babylon. geschichten, Recklinghausen.
Reding, Josef (1960b): Die Harlem-Story, Kassel und Basel.
Reding, Josef (1962): Nennt mich nicht Nigger! Stories, Freiburg, Basel und Wien.
Reding, Josef (1963): PAPIERSCHIFFE GEGEN DEN STROM. Kurzgeschichten, Aufsätze, Tagebuchskizzen und Hörspiele, Recklinghausen.
Reding, Josef (1967): Ein Scharfmacher kommt. Kurzgeschichten, Recklinghausen.
Reding, Josef (1977): Schonzeit für Pappkameraden. Kurzgeschichten, Recklinghausen.
Reding, Josef (1978): Nennt mich nicht Nigger. Kurzgeschichten aus zwei Jahrzehnten, Recklinghausen.
Reding, Josef (1979): „Josef Reding an Walter Küpper“, in: Hedwig Gunnemann (Hg.): Josef Reding. Fünf Jahrzehnte Leben – Drei Jahrzehnte Schreiben. Zeugnisse seines Lebens, Dortmund, S. 30f.
Reding, Josef (1981): Die Stunde dazwischen. Zehn Geschichten, Basel.
Reding, Josef (1984): Papierschiffe gegen den Strom. Erkundungsfahrten eines Schriftstellers, Freiburg, Basel und Wien.
Reding, Josef (2020): Nennt mich nicht Nigger. Kurzgeschichten aus zwei Jahrzehnten, Essen.
Spivak, Gayatri Chakravorty (2008): „Can the Subaltern Speak?“, in: Dies.: Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation, Wien, S. 17–117.
Wachendorfer, Ursula (2001): „Weiß-Sein in Deutschland. Zur Unsichtbarkeit einer herrschenden Normalität“, in: Susan Arndt (Hg.): AfrikaBilder. Studien zu Rassismus in Deutschland, Münster, S. 87–101.
Waldenfels, Bernhard (1990): Der Stachel des Fremden, Frankfurt am Main.
West, Cornel (1994): Race Matters, New York.
Wittkowski, Joachim (o. J.): „Vom Romanheft zum Jugendbuch. Josef Reding und die Spannenden Geschichten“, in: www.josef-reding.de/vom-romanheft-zum-jugendbuch/ [25.08.2023].
Über den Autor:
Stefan Hermes, PD Dr., ist Oberstudienrat im Hochschuldienst am Institut für Germanistik der Universität Duisburg-Essen. 1999–2006 Studium der Neueren deutschen Literatur, Linguistik sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin, 2006–2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germanistik der Universität Hamburg, 2009–2017 akademischer Mitarbeiter am Deutschen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, seither in Essen tätig. Gastdozenturen bzw. Forschungsaufenthalte in Nottingham, St. Petersburg, Stellenbosch, Riga, Prag, Storrs/Connecticut und Nijmegen. Promotion 2009 in Hamburg mit der Dissertation ,Fahrten nach Südwest‘. Die Kolonialkriege gegen die Herero und Nama in der deutschen Literatur (1904–2004), Würzburg 2009, Habilitation 2020 in Essen mit der Habilitationsschrift Figuren der Anderen. Völkerkundliche Anthropologie und Drama im Sturm und Drang, Bielefeld 2021. Herausgabe mehrerer Sammelbände, darunter (gemeinsam mit Michaela Holdenried und Alexander Honold) Reiseliteratur der Moderne und Postmoderne, Berlin 2017. Zahlreiche Aufsätze zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts.
stefan.hermes@uni-due.de